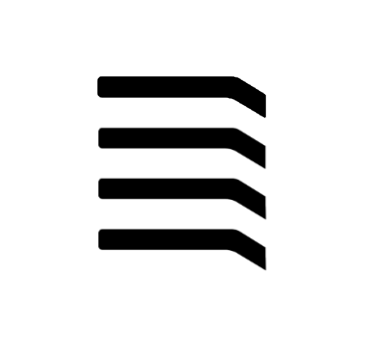r (A HN 274822 75 2 A Samstag, 12. September 1930 —————ů—— Mufin im reien im alter Joi Von Dr. Karl Bleſſinger⸗München Man hat heute beinahe vergeſſen, welch breiten Raum im muſikaliſchen Leben unſerer deutſchen Ver⸗ gangenheit das Muſſzieren unter freiem Himmel eingenommen hat. Mögen auch die klima⸗ tiſchen Verhältniſſe es verhindert haben, daß die Muſik im Freien ſich ſo üppig entfalten konnte wie in ſüdlicheren Ländern, ſo bietet ſich uns doch ein reiches und mannigfaltiges Bild. Geſang und In⸗ ſtrumentalſpiel traten in eifrigen Wettbewerb; ſel⸗ tener iſt es, daß beide ſich vereinigen. Bunt gemiſcht ſind die Kreiſe, die ſich daran beteiligen, dement⸗ ſprechend auch die verſchiedenartigſten Zwecke, denen dieſe Freiluftmuſik zu dienen hatte. Daß dabei der offene oder verſteckte Bettel in beſonders ſtarkem Maße hervortritt, iſt nicht zu beſtreiten; aber im all⸗ gemeinen kann doch geſagt werden, daß der Bettel micht ausſchließlicher Hauptzweck geweſen iſt; viel⸗ mehr hat unſere muſikaliſche Kultur auch von dieſer Seite her manche nicht zu unterſchätzende An re⸗ gung empfangen. Nur ſehr bedingt können wir die fahrenden Spielleute des Mittelalters unter dem Ge⸗ ſichtspunkt der Art ihres Broterwerbs beurteilen. Mögen ſie auch rechtlich als ehrlos gegolten haben, ſo war ihre Exiſtenz doch eine kulturelle Not⸗ wendigkeit, und überall wurden ſie mit offenen Armen willkommen geheißen. In der ſchönen Jahreszeit gehörte das Tunzen im Freien zu den be⸗ liebteſten Vergnügungen. Freilich war es dabei oft genug mit der Muſik nicht zum beſten beſtellt. Der Chorus der Teilnehmer ſang ſeine Tanzlieder, ſo gut es eben gehen wollte. Eine Belebung des muſi⸗ kaliſchen Teiles konnte nur von den Spielleuten aus⸗ gehen, die nicht nur mit ihren Inſtrumenten eine willkommene Abwechflung brachten, ſondern auch als Vermittler neuer Lieder und Weiſen eine beachtliche Sendung erfüllten. Freilich ſanken dann im Laufe der Zeit die Spielleute teilweiſe zu reinen Bettel⸗ muſikanten herab, während die anderen ſich ſeßhaft machten und in den Städten als Turmpfeifer oder Stadtmuſikanten in anderer Weiſe das Muſikleben bereicherten. Aber der Schritt vom Bettelmuſikanten zum an⸗ geſehenen Künſtler war ehemals nicht ſo groß und ſchwer wie ſpäterhin. Die Schule bildete das Ver⸗ bindungsglied. Hier wurde die Muſik mit gro⸗ ßem Eifer gepflegt, zwar zunächſt im Intereſſe der Kirche, dann aber auch, um Mittel zur Unterſtützung armer Schüler, ja für die Erhaltung der Schule ſelbſt zu gewinnen. Dieſem Zwecke diente das Straßenſingen, das noch vor 150. Jahren nicht ausgeſtorben und deſſen bekannteſte Form der Kur⸗ rendegeſang war. Daneben iſt das Straßenſingen zur Weihnachtszeit ſehr verbreitet geweſen, aller⸗ dings nicht ohne durch erheblichen Wettbewerb an⸗ derer Kreiſe beeinträchtigt zu werden, zu denen ein⸗ zelne Zünfte wie die Leineweber, aber auch die Mei⸗ ſterſinger gehörten. Den Vorrang einer weit über⸗ legenen Kultur konnte jedoch den Schülerchören nie⸗ mand ſtreitig machen. Mit dem Aufblühen der Inſtrumental⸗ muſik tritt in unſerem Bereiche der G eſang all⸗ mählich etwas zurück. Die Stadtpfeifer erſcheinen im Freien allerdings nur bei Repräſentationsmuſi⸗ ken, bei Empfängen, Aufzügen uſw., wo ſie ihre In⸗ traden zu blaſen pflegten, das ſind fanfarenähnliche Stücke feſtlichen Charakters, die aber doch von den echten Fanfaren der privilegierten Trompeter⸗ und Paukerzunft erheblich verſchieden waren. Die Turm⸗ muſtkanten bildeten eine Gilde für ſich. Das Turm⸗ blaſen diente in erſter Linie erbaulichen Zwecken; doch ſpielte man neben frommen Liedern auch heitere Stücke, vor allem von tanzartigem Charakter. Die ſchöne Sitte des Turmblaſens iſt heute von einem romantiſchen Nimbus umgeben. Aber die Praxis nahm ſich weniger romantiſch aus. Bei aller er⸗ ſtaunlichen Vielſeitigkeit brachten es die Turmbläſer nur zu einem recht handwerksmäßigen Muſizieren, und wie armſelig und gedrückt oft ihr Leben war, darüber haben wir aus derb humorvollen Schilde⸗ rungen genugſam Kenntnis. Natürlich war auch in Deutſchland die Sitte des Ständchen bringens ſeit langem verbrei⸗ tet. Die Studenten ſind hier wohl mit ihrem Brauche des Gaſſatengehens(Sassatim von Gaſſe mit lateiniſcher Endung) vorangegangen. Aber recht bald wurde dieſer Brauch in militäriſchen Kreiſen nach⸗ geahmt. Schon aus dem 17. Jahrhundert haben wir Berichte darüber, daß den Offizieren eine„Schal⸗ meyen⸗ und Fagottmuſik“ präſentiert wurde, wenn auch nicht als regelmäßige Erſcheinung. Von hier aus haben ſich die noch heute beliebten Stand⸗ und Parademuſiken entwickelt. Daß auch an den Höfen dann und wann eine feſtliche Muſik im Freien ſtattfand, iſt eigentlich ſelbſtverſtändlich. Das be⸗ rühmteſte Beiſpiel dafür— Händels Waſſermuſik wurde zu einer Luſtfahrt des engliſchen Königs auf der Themſe geſpielt. Hier zeigen ſich im Gegenſatz zu den etwas derben Darbietungen der ſtudentiſchen Ständchen bedeut⸗ ſame Elemente höherer muſikaliſcher Kultur. Der Gipfel dieſer Ständchenmuſik wird durch Ver⸗ ſchmelzung kunſtmäßiger und volkstümlicher Ele⸗ mente erreicht, und zwar im deutſchen Süden, vor allem in Wien. Das Schaffen unſerer großen Meiſter der Tonkunſt, eines Mozart, ja eines Beethoven, iſt nicht denkbar ohne jene köſtliche Wiener Serenadenmuſik, die edle Haltung, ſüdliche Grazie und lebendige Volkstümlichkeit mit⸗ einander vereinigt und ſich ſchließlich zu einer Höhe erhebt, die zu einer Steigerung der Gattung in höhere Formen und ſchließlich zu ihrer Verpflanzung in den Konzertſaal führt. Was weiterhin an Muſik im Hreien ſich in das 19. Jahrhundert hinüber gerettet hat, das ſind nicht viel mehr als kümmerliche Reſte geweſen. Die Romantik, die doch auch in der Muſik ſich mit Eifer der Pflege überkommener Werte zuwandte, Beilage der„Neuen Mannheimer Zeitung“ Querschnitt durch neue uſik Vom Internationalen Mufihfeſt in Lütten 5 Kammermuſik Die beiden Hauptgewinne: ein Streichquar⸗ tett von dem jungen Flamen Albert Huy⸗ brechts und ein Trio für Flöte, Violine und Violoncell von dem älteren Franzoſen Albert Rouſſel. Jenes zwar kein tiefſchürfendes Stück, aber bei ziemlich moderner, immer von der Vernunft zuſammengeriſſener Haltung muſikantiſch, blutwarm und von Einfällen überſprudelnd. Das andere ein Stück in Sonatenanlage, aber mit dem leichter wie⸗ genden Inhalte einer Serenade, mit dem klaren Formenſinn des Romanen geſtaltet, geiſtreich und verbindlich! Mit noch leichterer Hand— aber auch recht kalter —iſt eine ſechsſätzige Serenade für drei Bläſer, Violine und Violoncello von Alfred Caſella, dem bekannteſten italieniſchen Vertreter der zeitge⸗ nöſſiſchen Muſik, gearbeitet. Mit einem Septett für Bläſer, Bratſche, Violoneell und Klavier von ſeinem Landsmanne Karel Haba, dem Bruder des Vier⸗ teltöners, ſteht es nicht viel anders. Einer, der modern ſein will und es letztlich gar nicht iſt. Sin⸗ foniſcher gibt ſich der Oeſterreicher Karl Sti m⸗ mer in einem unentſchieden zwiſchen Impreſſionis⸗ mus und Expreſſionismus ſchwankenden Quintett für Altſaxophon und Streicher, aber es hat ſchwäch⸗ liches thematiſches Gerüſt und ermangelt überzeu⸗ gender Inſpiration Es ſei betont, daß die Tſchechoſlowakei ihre Künſtler wie immer ſo auch diesmal aus Staats mitteln entſandte, um ihre Kunſt und Künſtler im hellſten Lichte zu zeigen. Das Deutſche Reich tut bei ſolchen Gelegenheiten nie etwas, nicht einmal gewährt es für die Teil⸗ nehmer ſolcher Tagungen, auch wenn ſie im eigenen Lande ſtattfinden, die in den meiſten mitteleuro⸗ päiſchen Staaten übliche Reiſeermäßigung. Es ſoll ſich vorſehen, daß ihm andere Staaten nicht den Kunſt⸗ und Kulturrang ablaufen. Oper Eine moderne Oper will man uns— wohl in der Erkenntnis, daß es an künſtleriſchen Mitteln mangelt— in Lüttich nicht vorführen. Dafür ſpielte man eine altlüttiſche komiſche Oper von A. F. Gresnick(17521799), betitelt„Die falſchen Bettler“, deren Handlung mit Verkleidungs⸗ und Verwechflungsgeſchichten für die damalige Zeit typfſch 15 und deren Muſik ſich als verdünnter Auf⸗ guß von Mozart und volkstümlichem Geſang aus⸗ weiſt. Ihm folgte noch ein Ballett„Ländliche Tänze“ nach Muſik aus Werken Grétry 8, des fähigſten belgiſchen Operntonſetzers ſeiner Zeit(1741 bis 1813). Die Aufführungen machten zumal wegen eines mitelmäßigen Orcheſters und eines veralteten Ballettes kein ſonderliches Vergnügen. Zur Wiedergabe einer modernen Oper hatte ſich die Muſikgeſellſchaft des Aachener Stadtthea⸗ ters verſichert. Man fuhr in Kraftomnibuſſen nach der alten Kaiſerſtadt. Als Feſtvorſtellung war eine Wiedergabe des Wozzeck von Brückner⸗Be 1g auserſehen. Orcheſter⸗ und Chorkonzerte Die Bedeutung der Orcheſterdarbietungen blieb weit hinter den Kammermuſikveranſtaltungen zurück. Ein einziges Konzert hob ſich heraus: das Mili⸗ tär konzert, womit die Aufführungen im Aus⸗ ſtellungsgelände verheißungsvoll eröffnet wurden. Ihm kam aber dieſe Sonderſtellung weniger der ge⸗ Nr. 424 ſpielten Stücke als vielmehr der glänzenden Aus⸗ führung wegen zu. Das„Mlilitärorcheſter des Guides“, das insgeſamt 180 Köpfe zählt, aber wohl in einer Stärke von etwa 80 Mann auftrat, beſteht ausſchließlich aus Bläſern, die das Konſervatorium abſolviert haben. Ihre Virtuoſität iſt blendend, ihr Zuſammenſpiel unter Leitung ihres Muſikdirektors Prévoſt höchſt genau, rhythmiſch beſchwingt und in⸗ tonationsrein. Eröffnet wurde dieſes Nachmittagskonzert und damit das ganze Muſikfeſt mit zwei Stücken deutſcher Herkunft: Ernſt Tochs„Spiel für Blasorcheſter“ und Paul Hindemiths „Konzertmuſik“, Werk 41(mit den Va⸗ riationen über„Prinz Eugen, der edle Ritter“). Aus dem Mittelſatze des erſten, einer träumeriſchen Idylle, erſieht man, daß ſein Tonſetzer auch inner⸗ lichere Töne anzuſchlagen vermag, als man von ſeiner Virtuoſität gewöhnt iſt. Hindemiths Werk iſt nach ſeiner bekannten Art mit feinen, aber auch man⸗ chen plumperen Muſikſcherzen geſpickt. Das bedeu⸗ tendſte Stück der Vorführung war ein„Diony⸗ ſtaques“ betiteltes Tonſtück des Pariſers Flo⸗ rent Schmitt— von kraftvollem Rhythmus, denkbarer Bildhaftigkeit und doch muſikaliſch echt. Auf jedes einzelne Werk der eigentlichen Sy m⸗ phontiekonzerte näher einzugehen, lohnt nicht recht. Im allgemeinen kann man ſagen, daß die Tonſetzer in den vorgeführten Stücken merkwürdi⸗ gerweiſe wieder einem maſſiveren Orcheſterſatze zu⸗ ſtreben und die kammermuſikaliſche Durchſichtigkeit aufgeben. Ob dies Zufall, Anzeichen einer Wende moderner Muſikauffaſſung oder gar Mangel an der Beherrſchung der Orcheſtrierung iſt, ſei unentſchieden gelaſſen. Leider war aber trotz Verdickung der in⸗ ſtrumentalen Arbeit der muſikaliſche Gedanke faſt durchweg recht dünn geſponnen; ſo in einem Prä⸗ ludium des Rheinländers Ern ſt Pepping, der wohl auf chorgeſanglichem Gebiete ſein Wertvollſtes zu vergeben hat; auch in einem Trauergeſang (für Orcheſter allein) von dem Franzoſen Jean Rivier; ferner in einigen naturaliſtiſchen Zeit⸗ ſtücken: dem Posme de Espace(Hymnus auf Newyork und aufs Fliegen) von dem Belgier Mar⸗ cel Poot, einem ſymphoniſchen Allegro„Start“ von dem Tſchechen Pavel Borkovec und dem ganz kurzen, unglaublich realiſtiſchen Tonbilde „Eiſengießerei“ von dem Rüſſen A. Moſſo⸗ Jo w. 5 Mit dem Blick auf die gleichzeitige m uſikwülſ⸗ ſenſchaftliche Tagung wurden die zeitgenöſſi⸗ ſchen Vorführungen durch einige Darbietungen alter Chormuſik ergänzt. Den alten Ruf der belgiſchen Chorvereine hielt vor allem der Lütticher A⸗Cappella⸗ Chor unter Leitung F. Mawetts hoch; er wirkte in einem Altlüttiſcher Muſik gewidmeten Konzert mit; ferner der erzbiſchöfliche Kirchenchor von Mecheln, der einen Gottesdienſt in der St. Pauls⸗Kathedrale reich mit alter Muſik ausſtattete, endlich der Chor geiſtlicher Konzerte aus Brüſſel, dem man unter G. Fitelbergs Führung die Wiedergabe eines Stabat maler von K. Szymanowſki verdankte, des einzigen größeren modernen Chorwerkes dieſer Tage, und zwar eines ſe beachtenswerten, religiös erfühlten Stückes. Dagegen fiel die Schola Cantorum aus Brüſſel, eine Geſangskörperſchaft nach Art un⸗ ſerer Madrigalvereinigungen, in einem Konzert mit alter A⸗Cappella⸗Kunſt wegen Intonationsunſauber⸗ keiten und ſonſtiger Untugenden ab. Dr. M. U. — verſagte in dieſer praktiſchen Frage. An die Stelle der fröhlichen Nachtmuſik im Freien ſetzte ſie die ſentimentale Nocturne für den Salon, die bei aller Schönheit einzelner dieſer Stücke doch ein lebensfremdes Gebilde bleibt und jedenfalls nicht dazu beigetragen hat, die damals ſchon gefährdete Einheit von Kunſt und Leben wieder zu befeſtigen. Es iſt faſt eine Ironie des Schickſals, daß gerade heute, wo man die Romantik überwunden zu haben glaubt, von Würzburg ausgehend eine Bewegung eingeſetzt hat, die ſich eine Erneuerung der köſt⸗ lichen Serenadenmuſik der Mozartſchen Zeit zum Ziele ſetzt. Mechaniſterung der Militärmuſik Wie der„Mancheſter Guardian“ mitteilt, wird in Amerika verſucht, auch die Militärmuſik zu mecha⸗ niſteren. Ein großes Grammophon ſoll in einem Panzerwagen ein montiert werden, und die Töne werden durch große Verſtärker und mehrere Laut⸗ ſprecher nach vorn und rückwärts geſandt. Es wird verſichert, daß ein ſolcher Muſikwagen ſo laut ſpiele, wie zwei Kapellen zuſammen. Die Unterhaltungs⸗ koſten ſeien niedriger, wie die Ausgaben für einen Tambourmajor. Sofort nach Bekanntwerden dieſer Abſicht habe ſich ein Proteſtſturm aus den Reihen der Militärmuſiker erhoben, die ſich ſchon ebenſo ums Brot gebracht ſehen, wie die Kinomuſiker in⸗ folge des Tonfilms. Fürwahr, wir gehen herrlichen Zeiten entgegen! „Unſere Stadt“. Lied von Dr. Bernhard Bollen⸗ bach. Als nachgelaſſenes Werk des allzufrüh ver⸗ ſtorbenen Muſikpädagogen und Kritikers Dr. Bern⸗ hard Bollen bach erſcheint ſoeben ſein Lied „Unſere Stadt“ im Druck. Es iſt ein Hymnus auf die Stadt der Arbeit; den ſchwungvollen Text dichtete Dr. Karl Laux. Wie dumpfe Rhythmen der„großen, grellen Arbeitsſymphonie“ die Stadt durchſchüttern, tönen hämmernde Nonenakkorde der Baßbegleitung an; die vollgriffige fallende Diskant⸗ ſtimme in Moll verſtärkt die graue Nebelſtimmung. Dann lichtet ſich der Tonſatz, wenn der Text von ſchlanken Türmen, Parks und Kinderſpielen ſpricht. Am Schluß verklärt ſich die Stimmung unter„des Himmels Feuerblume in goldnem Abendrot“ zu ſtrahlendem Dur hochliegender Harmoniefolgen.(Die Liebestod⸗Chromatik iſt hier nicht nachempfundener Anklang, ſondern entwickelt ſich folgerichtig aus dem Vorhalten des„Arbeits“ ⸗Motivs.) Die hymniſche Melodik leiner Mittelſtimme) findet in der Beglei⸗ tung ihre Stütze. Der Klavierſatz liegt grifflich und bereitet keine zu großen Schwierigkeiten, wenn der Begleiter gut leſen gelernt hat. Allerdings hätte die Lesbarkeit durch verdeutlichende Vorzeichen, Angabe der Phraſierung und Fingerſatz gewonnen. Einige Druckverſehen wird der kundige Spieler ſelbſt ver⸗ beſſern. Der Verlag von J. V. Blatz in Ludwigs⸗ hafen ſorgte für eine geſchmackvolle Ausſtattung mit vierfarbigem Titelblatt(von Erbelding), das die Arbeitsſtadt im goldnen Abendrot ſinnbildlich zeigt. Gewidmet iſt Bollenbachs Schwanengeſang der Stadt Ludwigshafen und ihrem Oberbürgermeiſter Dr. Weiß. Bei der Uraufführung mit Begleitung des Pfalzorcheſters konnten wir im Vorjahr einen ſchönen Erfolg unſeres damaligen Ludwigshafener Muſikreferenten und der ſein Lied ſingenden Gattin Toni Bollenbach vermelden. —— Literatur Deutſch und Muſikunterricht mit beſonderer Berück⸗ ſichtigung der höheren Schulen. Von Dr. F. Ober bor⸗ beck. Muſikpädagogiſche Bibliothek, Heft 6. Verlag Quelle u. Meyer, Leipzig. Die neuen Unterrichtsreformen ver⸗ ſolgten den Zweck, den Muſikunterricht aus ſeiner Sonder⸗ ſtetlung, die er an höheren Schulen bisher einnahm, zu löſen und ihn möglichſt enge mit dem Deutſchunterricht zu verknüpfen. Beide Fächer, Muſik⸗ und Deutſch⸗Unterricht ſollen von nun an demſelben großen Ziel, der Kunſt⸗ erziehung dienen. Damit hat auch der Aufgabenkreis der genannten Unterrichtsgegenſtände eine bedeutende Erwei⸗ terung erfahren, die nur dann zum gewünſchten Ziele führt, wenn die Vertreter dieſer Fächer Hand in Hand ar⸗ beiten. Gewiß ergeben ſich angeſichts der Neueinführung vielfache Schwierigkeiten, nicht zuletzt in methodiſcher Hin⸗ ſicht. Wie ſich diefe Schwierigkeiten löſen laſſen, zeigt der als hervorragender Pädagoge und ausübender Muſiker, namentlich als Dirigent bekannt gewordene Verfaſſer Dr. Oberborbeck(Remſcheid) im vorliegenden, gerade we⸗ gen ſeiner praktiſchen Fingerzeige ſehr anregenden Büch⸗ lein. In den einleitenden Kapiteln weiſt er zunächſt auf die Verbindung von Sprache und Muſik hin, und beſpricht welterhin eingehend die Querverbindung beider Fächer. Mobung macht immer nock den Meister Einige Hinweiſe von Dr. Otto Chmel Vielfach wird darüber Klage geführt, daß die heutige Jugend für den Muſikunterricht viel ſchwerer zu gewinnen ſei als in verfloſſenen Zeitläuften, da die mannigfaltigen Ablenkungen durch Kino, Grammophon, Radio etc. ſich noch nicht bemerklich machten. Ebenſo unbeſtritten bleibt aber die Tatſache, daß ein Lehrer, der es verſteht, ſich in das Seelenleben des Schülers zu verſetzen i und ſeinen Zögling zur aktiven Mitarbeit zu erziehen, nach wie vor nicht nur große Erfolge im Unterricht, ſondern auch innere Befriedigung als ſchönſten Lohn davontragen wird. Wie man den Unterricht, ſpeziell den Klavierunterricht wahrhaft ſchöpferiſch geſtalten kann, davon legt das ungemein anregende Buch „Der lebendige Klavierunter richt, ſeine Methode und Pſychologie“ von Margit Varrs erfreuliches Zeugnis ab.(Erſchienen bei Simrock, Berlin.) Was in dem flüſſig geſchriebe⸗ nen Buch der in Budapeſt wirkenden Klavierpädago⸗ gin beſonders angenehm auffällt, iſt die eingehende Berückſichtigung der verſchiedenen Schülertypen und die Anweiſung zu ihrer Beobachtung. Die Verfaſſerin erweiſt ſich als Lehrerin von auffallend großer Blick⸗ weite und Literaturkenntnis, erwartet aber auch von dem ernſthaft Mitſtrebenden die Bereitwilligkeit, ſein Wiſſen, vor allem auf pfychologiſchem Gebiete zu erweitern. Der Gehörbildung iſt ein breiter Raum gegönnt, ferner verdienen eingehendſte Beachtung die Kapitel:„Lerntechnik, die Entwicklung des muſtkalt⸗ ſchen Geſchmäacks und Urteils“, über„moderne Kla⸗ biertechnil, Behandlung von Schülern mit verdorbe⸗ ner Spieltechnik“. Außerordentlich ſchätzenswerte Winke für Lehrer und Schüler enthält der Ab⸗ ſchnitt„über das Klavierüben“, wobei nicht oft genug eingeſchärft werden kann, daß mit dem mechaniſchen, wenn auch noch ſo ausdauernden Wiederholen und Büffeln einer ſchwierigen Stelle nichts erreicht wird, ſondern einzig und allein eingehende Analyſe und Durchgeiſtigung des Uebungsſtoffes, verbunden mit planvoller Ueberwindung der Schwierigkeiten(durch Transponieren und Sequenzenbildung) zum Ziele führt. Das reichhaltige Buch der geiſtvollen Päd⸗ agogin Varrs wird auch dem erfahrenen Lehrer viel⸗ fache Anregung verſchaffen, in erſter Linie gehört es in die Hand jedes angehenden Lehrers, dem es vor allem die Augen öffnen wird über die große Verantwortung, die man mit dem Beruf des Muſik⸗ lehrers auf ſich nimmt, dem es aber auch Mittel und Wege zu erfolgreicher Tätigkeit an die Hand gibt. 8 An vorgeſchrittene Spieler, denen insbeſonders die Aneignung virtuoſer Paſſagentechnik am Herzen liegt, wendet ſich die Broſchüre:„Die einfachen und zuſammengeſetzten Rollung en im Klavierſpiel“ von Dr. Karl Schuch lerſchienen im Verlag Univerſitätsbuchhandlung Leuſchner und Lubenſky, Graz). Ueber keinen Faktor des kunſt⸗ gerechten Klavierſpiels wurde in den modernen An⸗ ſchlagstheorien ſo viel diskutiert und ſo viel wider⸗ ſprechende Anſchauungen verbreitet als gerade über die Rollung. Es fehlte nicht nur Klarheit über die beteiligten Muskelgruppen, ſondern auch über die Zielrichtung. Nun hat es der in Graz ſchon längſt als tüchtiger Pianiſt und Klavierpädagoge vorteil⸗ haft bekannte Verfaſſer des vorliegenden Werkes unternommen, die von den Theoretikern Eugen Tetzel und Rud. Breithaupt dargelegten An⸗ ſchauungen über Weſen und Zweck der Rollung noch weiter auszubauen und vor allem in ein geſchloſ⸗ ſenes, lückenloſes Syſtem zu bringen. Dr. Schuch darf ſich das Verdienſt zuſchreiben, genaue Unterrichtsanweiſungen für dieſes ſchwierige Gebiet gegeben zu haben. Schuchs Werk verdient, abgeſehen von ſeiner auf die Praxis weiſenden Zielrichtung, ſchon deswegen ernſteſte Beachtung aller auf vir⸗ tubſes Paſſagenſpiel bedachten Pianiſten, weil es die erſte Monographie über Rolltechnik überhaupt darſtellt und den Leſer mit vollkommen neuen Ge⸗ ſichtspunkten bekannt macht, ſo z. B. mit den Be⸗ griffen der„Ausholung“ und„Zielrolle“, die die Eckpfeiler ſeines Syſtems bilden. In ſeinem unbe⸗ dingt zu empfehlenden Buche ſind phyſtologiſcht Kenntniſſe mit ausgebreiteter pädagogiſcher Erfah⸗ rung gepaart. Auch auf geſangstechniſchem Gebiete können wir auf ein Buch aufmerkſam machen, das geeignet iſt, den Unterricht auf vollkommen neue Grundlage zu ſtellen. Der bekannte Berliner Geſangsmeiſter Dr. Paul Bruns gelangt in ſeiner Schrift„Min i⸗ malluft und Stütze“(Verlag Walter Göritz. Berlin⸗Charlottenburg), ausgehend von tiefſchürfen⸗ den Betrachtungen über die Geſangstechnik Caruſos zu Erkenntniſſen über die Atmung, die im vollſten Gegenſatz zu den bisher gelehrten Methoden zu einem vollkommen neuen Atemtyp führen. Bruns fordert in erſter Linie ausgiebige Entſpannung des vom Druck der umliegenden Muskelgruppen befreiten Zwerchfells, das die Grundlage des von ihm be⸗ fürworteten Freilaufs bildet und ungeahnte Schallreflexe erſchließt. Iſt einmal das Prinzip des Freilaufs richtig erfaßt und dadurch viele Hemmun⸗ gen beſeitigt, ſo erlebt der Sänger das elektriſte⸗ rende Bewußtſein einer ungeahnten räumlichen Deh⸗ nung des Reſonanzkörpers ohne Stauung des auf⸗ geſparten Atems. Mit beſonderer Schärfe zieht der kenntnisreiche Verfaſſer in ſeinem Schlußabſchnitt „Die menſchliche Stimme im Kampf mit Orcheſter und Inſzene“ gegen gewiſſe Schattenſetten des heu⸗ tigen Theaterbetriebes zu Felde, auf die wir, da ſie für die Allgemeinheit beſonders wichtig ſind, ge⸗ legentlich ausführlich zurückzukommen uns vorbehal⸗ ten. Von großer Wichtigkeit ſind die von Bruns empfoh⸗ lenen, geſchickt erdachten Übungen zur Innerpferung des Zwerchfells unter Zuhilfenahme der Konſonau⸗ ten, die bel ausdauernder Uebung zur bewußten Kontrolle des Zwerchfells führen und ernſthaft Stu⸗ dierenden nicht genug empfohlen werden können.
Ausgabe
141 (13.9.1930) 424. Abendblatt
Einzelbild herunterladen
verfügbare Breiten