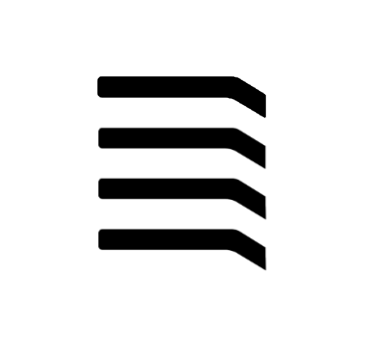350 Jahre Mannbeimer Kultur
von Oberarchivrat Dr. Gustaf facob, Leiter des Städt. Archivs
Wer die kulturelle Entwicklung der Stadt Mannheim in den vergangenen 350 Jahren im großen überblickt, wird drei Phasen unterscheiden müssen, die deutlich in die Augen springen:
Die kulturellen Leistungen am kurfürstlichen Hof
(17. u. 18. Jahrhundert),
Die Kulturförderung durch das Bürgertum
(19. Jahrhundert),
Die kommunale Kulturpflege(20. Jahrhundert). Die erste Phase im geschichtlichen Ablauf beginnt, als Mannheim sich zu einem städtischen Gemeinwesen ent- wickelt und einen gewissen Wohlstand erreicht hatte. Erst die Stadt Mannheim wurde zum Schauplatz geistiger und kultureller Schöpfungen. Unternehmende Persönlichkeiten traten jetzt hervor, allen voran der Pfälzer Kurfürst, der als politischer Führer auch die Geldmittel ansammelte und sie vorzugsweise für das Bauwesen nutzbar machte. So trifft man schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf dem heutigen Schloßgebiet ein kleines kurfürstliches Palais an, das der aus Paris stammende Architekt Daniel la Rousse 1664 errichtet hatte. Es bleibt bemerkenswert, daß Kurfürst Karl Ludwig ein Jahrzehnt später sich mit dem Gedanken eines prächtigeren Schloßbaues trug und den französischen Architekten Jean Marot zu einem Entwurf veranlaßte. Die- ser aus einer Hugenottenfamilie stammende Baumeister, der auch einen Plan zum Louvre in Paris entworfen hatte, sah für Mannheim ein hufeisenförmiges Schloßgebäude in Ver- bindung mit dem Pavillonsystem vor, ein ähnliches Projekt, wie es später etwa in Prinz Eugens Sommerschloß Belvedere bei Wien verwirklicht wurde. Blieb Marots Mannheimer Entwurf der hohen Kosten wegen nur auf dem Papier, so wurde doch la Rousses bescheidenere Anlage zum Mittel- punkt mancher höfischen Prachtentfaltung. Im Wettstreit der Künste traten damals die Musik und das Ballett hervor. Man darf an das erste in Mannheim nachweisbare Bühnen- stück:„Die über Mars triumphierende Anmut“ erinnern, das man am 22. Oktober 1683 im kurfürstlichen Schloß anläßlich des Besuches des Markgrafen Johann Friedrich von Brandenburg gab. Es war ein Festspiel, bei dem Oper, Schauspiecl und Maskerade sich in seltsamer Mischung mit Historie und Allegorie vereinigte. Ahnlichen Tendenzen begegnet man bis weit ins 18. Jahrhundert hinein.
Seit dem Jahre 1720 traten neue kulturelle Aufgaben auf, nachdem sich Kurfürst Karl Philipp entschlossen hatte, die alte Bergfeste Heidelberg zu verlassen und Mannheim, die Stadt der Ebene, zur kurpfälzischen Residenz zu erheben. Der Wille, in dieser Stadt die schöpferische Macht des Für- sten zu entfalten, führte zu ungeahntem Aufstieg. Schnell setzte eine fieberhafte Bautätigkeit ein. Alle wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Faktoren mündeten in der reprä- sentativen Stadtansicht, deren Architektur die Kunst des Barock geprägt hat. Die bezeichnendste und bemerkens- werteste baukünstlerische Leistung ist das Mannheimer Schloß, das in vier Jahrzehnten, von 1720- 1760, empor- wuchs. Die Außenarchitektur dieses monumentalen Bau- werks von sechshundert Metern Länge zeichnet Klarheit und Ubersichtlichkeit aus. Ihre Schwerpunkte bilden: Der dreiflügelige, in der Mittelachse der Stadt um einen Ehren- hof gelegene Hauptbau— die turmartig wirkenden Pavil- lons— das vor die Fassade des corps de logis gestellte Haupt- treppenhaus— die Gliederung der Seitenflügel am Ehrenhof durch offene Pfeilerarkaden— die reiche Abwandlung der Dachformen— die Betonung der Giebelfassaden der Schloß- kirche und der ehemaligen Bibliothek. Diese baukünstle- rischen Ideen erwuchsen aus dem leidenschaftlichen Willen der Pfälzer Kurfürsten, in Mannheim den größten Schloßbau- Deutschlands erstehen zu lassen. Sie fügten sich in diestädte- bauliche Gesamtanlage der neuen Residenz organisch ein. Das Mannheimer Schloß ragte indessen nicht nur als das bedeutendste Bauwerk der Kurfürstenzeit hervor, es war zugleich ein geistiger und kultureller Mittelpunkt des kur- pfälzischen Landes und beherbergte die Schätze fürstlichen Sammelwesens. Wer etwa um das Jahr 1770 das kurfürst- liche Mannheim besuchte, dem zählte der„Kleine Pfälzische Kalender“— der damalige Stadtführer— eine stattliche Reihe von Sehenswürdigkeiten auf. Darunter nahmen die Muscen oder, wie man damals sagte, die Cabinette eine hervorragende Stelle ein. So das Münzkabinett, die Schatz- kammer, die Sammlung von Gemälden, das Kupferstich- und Zeichnungskabinett, das Kabinett der natürlichen Historie, das Antiquitätenkabinett und der Saal der Statuen. Mit Ausnahme des letzteren, der zur Zeichnungsakademie ge- hörte und Lehrzwecken diente, waren sie im Schloß unter- gebracht und allgemein zugänglich.