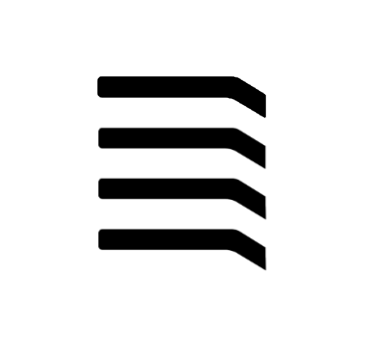F c/... r Kürſchnerfamilie Schwenzke. Im Eckhaus H 1. 14, das lange der Ratsherrenfamilie Fuchs gehörte hatte mehrere Jahre hindurch(bis 1801) die bekannte Buchhandlung von Schwan und Götz ihren Buchladen. 5 In der Mitte des Marktplatzes ſtand bis 1767 ein einfach geſtalteter Brunnen. Kurfürſt Karl Theodor überließ in dieſem Jahre das Marktplatz⸗Mo⸗ nu ment der Stadt als Geſchenk. Die Koſten der Aufſtellung mußte die Stadt tragen. Die urſprüng⸗ lich die vien Elemente verkörpernde Sandſteingruppe iſt ein Werk des Bildhauers Peter van den Branden; ſte wurde 1719 im Heidelberger Schloßgarten aufge⸗ ſtellt und kam 1763 nach Schwetzingen. Da ſie ſich aber zur Verwendung im dortigen Schloßgarten nicht eignete, ſchenkte ſte der Kurfürſt auf Vorſchlag des Oberbaudtrektors Pigage der Stadt. Johann Ma⸗ thäus van den Branden, der Sohn des Verfertigers, ergänzte ſie durch eine fünfte Figur— den auf der Rückſeite ſitzenden Flußgott Neckar— und ſo ver⸗ ſinnbildlicht ſie nun die am Rhein und Neckar durch Handel und Verkehr aufblühende Stadt Mannheim. Auf dem von Pigage in klaſſtziſtiſchem Stil entworfe⸗ nen Sockel iſt die Geſchichte des Marktplatzbrunnens in lateiniſchen Inſchriften berichtet. Um dieſen Brunnen herum ſpielte ſich ſchon in alten Zeiten ein reges und farbenreiches Markt⸗ leben ab. Von jeher waren die drei Markttage: Montag, Donnerstag und Samstag. Ein anſchau⸗ liches Bild gibt Rieger in ſeiner 1824 erſchienenen Beſchreibung von Mannheim:„Hter auf dieſem Platz iſt nun jeden Tag der Segen der Pfalz ausgegoſſen. Außer den hieſigen Obſt⸗ und Gemüſehändlern und einigen Bäckern, welche daſelbſt bei Sturm, Regen und Wind, ſo zu ſagen, ihre Wohnung aufgeſchlagen haben, bringen die Landleute aus der Gegend die Landesprodukte, welche an keinem anderen Orte der Stadt ausgeſtellt werden dürfen, zum Kaufe. Wer aber recht bewundern will, welchen Reichtum die Umgebung hervorbringt, der durchwandle zur Ernte⸗ zeit an einem der drei Hauptmarkttage die Reihe der zahlreich Feilbietenden. Man findet alsdann auch am beſten Gelegenheit, die verſchiedenen Phyſiog⸗ nomien der Dorfbewohner, von denen alle, die einen gemeinſchaftlichen Wohnort haben, beiſammen ſtehen, zu vergleichen. Den reinlichen, ſchmucken Ueber⸗ rheinerinnen mit ihren heitern, lebens friſchen Ge⸗ ſichtchen und wohlgebildeten Zügen wird jeder den Vorzug geben. An den Marcttagen trügt aber auch ein großer Teil der Mannheimer Gewerbsleute ſeine Arbeiten hierher zum Verkauf, und es reihen ſich alsdann neben die Bäckerbuden kleine Metzgerbänke; der Mehlhändler legt Mehl und dürre Früchte, der Töpfer ſeine zerbrechliche Ware in großen Partien aus; der Blech⸗ und Zeugſchmied, der Zinngießer hängt ſeine blanken Gerätſchaften auf, Leinwand⸗ händler, Kürſchner, Strumpfweber, Schuhmacher, Buchbinder, Korbflechter, Kübler, Wollehändler und Andere ſitzen hier nebeneinander; Ellenwaren und eine Menge Kleinigkeiten, die der induſtrißſe Mann⸗ heimer zum Erwerbszweige macht, werden beſon⸗ ders an die Landleute, verkauft. Unter dieſem bunten Gemiſch von Käufern und Verkäufern treibt alsdann noch der Trödeljude, auf dem beſonders angewieſe⸗ nen Platze, ſein Weſen und ſelbſt der Scheerenſchlei⸗ fer fehlt nicht. Hier werden auch zur Meßzeit die Buden der Handelsleute, welche autor dem Kaufhaus keinen Platz finden, aufgeſchlagen, und zur Weih⸗ nachtszeit der Chriſtmarkt da gehalten“ Zeitweiſe wurden Teile des Marktplatzes zur Meß⸗ zeit von Verkaufsbuden und Schaubuden benützt. Unſere beiden Hauptmeſſen, die Mai⸗ und Schauſpielhauſes für die Bürgerſchaft. Im genann⸗ ten Jahre ſchloß der Schauſpielunternehmer Seba⸗ ſtiant einen Vertrag mit dem Zimmermeiſter Lorenz wegen Errichtung dieſer Komödienhütte, in der dann auch in den folgenden Jahren wandernde Schau⸗ ſpielgeſellſchaften auftraten. „Justitiae et pietati“ ſo lautet die Inſchrift unter den Figuren der Gerechtigkeit und Frömmigkeit auf dem Rathausgiebel. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde im Rathaus auch Recht geſprochen, der Stadt⸗ rat war zugleich das Stadtgericht für die niedere Gerichtsbarkeit. Häufig war der Markt der Schauplatz von Exe⸗ kutionen. An dem Pranger und Läſterſtuhl vor dem Rathauſe wurden im 17. Jahrhundert die Verur⸗ teilten zur Schau geſtellt. Seitdem zu Beginn des 18. Jahrhunderts das Hochgericht außerhalb der Stadt über dem Neckar ſeinen Platz gefunden hatte. kamen Hinrichtungen auf dem Marktplatz nicht mehr vor, ſtimmung. Große Volksbeluſtigungen auf dem Marktplatze erfüllten die folgenden Tage. Auch manche feſtliche Beleuchtung iſt in den Erlebniſſen des Marktplatzes verzeichnet. So beim Regierungsjubiläum Karl Theodors 1792, wo ſie in der Feſtſchrift folgendermaßen geſchildert iſt:„Was aber dem Marktplatze noch den größten und voll⸗ kommenſten Glanz gab, und ihn wie der helle Mittag erleuchtete, war das Rathaus, welches die vierte Seite desſelben begränzet. Als ein ehrwürdiges Ge⸗ bäude in gravitätiſchem Gewande ſtand es da, als ein Tempel vorgeſtellt, mit zahlloſen Kerzen und Lichtern beſetzt; die an demſelben befindlichen Altane war gleichſam eine Quelle des Lichtes, das ſich noch wie in einer Flammenſpitze über das Dach⸗ geſims hinaus bis auf das Dach ſelbſt erſtreckte. Der Eingang unter der Altane war auswendig mit bren⸗ nenden Lampen auf das zierlichſte eingefaßt; in⸗ wendig aber ſtellte er durch die hintereinander ge⸗ reiheten, mit Lichtern bedeckten Bogenſtellungen das — 5* ö... isn l n f 8 N— VPV(Sastgeher den dre Rotigen ze en an nin N al the ihre. Kings. 2 0 5 5. Sede e. 5 5 4* 5 war keis Rais 5 ae, Was man um 1850 gegenüber dem Baſſermann⸗Hauſe ſah Wie oft haben ſich in ſchweren Kriegszeiten die Truppen auf dem Marktplatze verſammelt, wie oft trat hier die Bürgerwehr auf feſtlichen oder ernſten Anläſſen zuſammen! Die Huldigungen der Bürger wurden in kurpfälziſcher Zeit regelmäßig auf offenem Markt entgegengenommen, ſei es durch den Landesherrn ſelbſt, ſei es durch kurfürſtliche Kommiſſäre. Auf einem Podium mitten auf dem Marktplatz thronend, nahm 1744 der junge Kurfürſt Karl Theodor die Huldigung der Mannheimer in. eigener Perſon entgegen. Wie manches Jeſt hat der Marktplatz erlebt. So 1707 die Feier des hundertjährigen Stadtjubilä⸗ ums, als die Bürgerwehr und alle Einwohner der Stadt feſtlich verſammelt waren. So 1722, als der Beſuch des Erzbiſchofs von Köln die Veranlaſſung zu großen Feſtlichkeiten war. Vom Heidelberger Tor Oktobermeſſe, reichen ihrer Entſtehung nach in die Gründungszeit Mannheims zurück. Durch pfalz⸗ gräfliche Verfügung von 1613 wurde als Termin der beiden Mannheimer Jahrmärkte Philipp⸗Jacobi und acht Tage vor Michaelis feſtgeſetzt. Dazu 55 noch als weitere Meſſe 1707 der Jubelmarkt aus Anlaß des erſten Stadtjubiläums. Dieſer Jubelmarkt ging nach beinahe hundertjährigem Beſtehen in 1 un⸗ ruhigen Zeiten zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein. Wie die Anfänge des Schauspiels auf den Jahr⸗ markt führen, ſo war auch hier der Marktplatz mit ſeiner 1769 errichteten bretternen Kom ödie n⸗ hütte der Ausgangspunkt eines ſtündigen deutſchen Zeſtzug bei der Einweihung der Kettenbrücke 1845 bis zum Rathaus bildeten die Bürgerwehrkompag⸗ nien und Handwerksgeſellen Spalier, auf dem Marktplatz war die Garniſon in Parade aufgeſtellt, um den fürſtlichen Gaſt zu begrüßen. Mit vielen Tauſenden von Ampeln und Kacheln waren die Straßen, insbeſondere das Rathaus, die Pfarrkirche und die kurfürſtliche Juterimsreſidenz in R 1 illu⸗ minkert. Mitten auf dem Marktplatz ſtand eine große reich beleuchtete Pyramide aus Tannenreiſig, vor de gebratetes Geflügel und Brot unter das Volk ver⸗ teilt wurde. Der aus dem Marktbrunnen ſtrömende rote und weiße Wein erhöhte bei den Einheimiſchen und vielen herbeigeſtrömten Menſchen die Fe brannt. Innere eines Prachttempels vor, in deſſen Mitte ein brennender Opferaltar ſtand, deſſen Feuer von einem daneben ſtehenden Genius durch Zugießen unter⸗ halten zu werden ſchien. Unbeſchreiblich iſt es, was die alſo beleuchtete Halle des Eingangs und überhaupt das Ganze für einen herrlichen und prächtigen An⸗ blick gewährte, zumal da es von anderen Gebäuden abgeſondert in ſeinem vollen Glanze allein prangte. Ein faſt unaufhörlich aus dieſem Feiertempel er⸗ ſchallender Klang von Pauken und Trompeten lockte eine Menge Menſchen herbei, die ſich in gedrängten Haufen davorſtellten und nicht ermüdeten, ihre Augen an dem ſchönen Anblick zu weiden.“ Ein anderes Bild aus der Geſchichte des Markt⸗ platzes! 1810, Zeit der von Napoleon J. verfügten Kontinental⸗Sperre. Die in den Tuchhandlungen aufgeſtöberten Stoffe angeblich engliſcher Herkunft s brannten vor ben Zelten, da und dort wurde ab⸗ gekocht, geſpielt und getrunken. Marketenderinnen eilten hin und her, heitere Muſtk lockte zum Tanz. Als 1845 die Kettenbrücke eingeweiht wurde, be⸗ wegte ſich der feſtliche Zug vom Marktplatz aus über die alte Schiffsbrücke auf das jenſeitige Neckarufer und kehrte von dort über die Kettenbrücke und über die Breite Straße in die Stadt zurück. Auf dem Marktplatz wurde Halt gemacht. Die Liedertafel trug einen Choral vor und Bürgermeiſter Jolly hielt die Feſtrede. In den politiſch bewegten 1840er Jahren war der Markt häufig die Stätte von Volks veyrſa mn m⸗ lungen; hier fand 1843 die große Feier des 95jährigen Beſtehens der badiſchen Verfaſſung ſtatt. Hier rechtfertigte ſich 1848 Karl Mathy, von der Bürgerwehr gegen die ihn bedrohende Menge ge⸗ ſchützt, vom Rathaus⸗Balkon aus gegen die Vor⸗ würfe wegen der Verhaftung Ficklers. 50006000 Menſchen ſollen anweſend geweſen ſein bet der Volksverſammlung, die am 20. Mai 1849 auf dem Marktplatz ſtattfand. Gar häufig iſt dieſer Platz in unruhigen Zeiten der Mittelpunkt von Tumulten und Zuſammen⸗ läufen geweſen. Ernſte und freudige Ereigniſſe wurden auf ihm von der Bürgerſchaft beſprochen. Eine ungeheure Menſchenmenge ſammelte ſich am 3. September 1870 auf dem Markt und ſang vater⸗ ländiſche Lieder, als die Nachricht von dem großen Sieg bei Sedan eintraf. Feſtchoräle ertönten am 4. März 1871 vom Rathausturm, von der Plattform des Feuerwächters aus, als der Friedensſchluß mit Frankreich gemeldet wurde.— Dies ſind nur einige kurz skizzierte Bilder aus den Erlebniſſen des Marktplatzes. Man müßte die Geſchichte Mannheims erzählen, wollte man alles berichten, was er im Wandel der Zeiten erlebt hat. Heute iſt der Markt nur ein Platz unter vielen. Schon lange konzentriert ſich nicht mehr auf ihm allein das ſtädtiſche Leben. Mit dem Wachſen der Stadt ſind neue Mittelpunkte entſtanden. Auch kann ſchon längſt der Markt nicht mehr allein die Bevölkerung mit Lebensmitteln verſorgen. Viel⸗ leicht wird in nicht allzuferner Zeit der Name nur noch hiſtoriſche Bedeutung haben, wie Fruchtmarkt, Strohmarkt, Gockelsmarkt und eine Markthalle an anderer Stelle die Verſorgung der Einwohner mit Lebensmitteln übernehmen. Nachdrückliche Betonung erfährt jetzt der Altſtadt⸗Markt dadurch, daß ſich an ihm, eines ſeiner ſtattlichſten Häuſer zu neuem Leben erweckend, ein großes einheimiſches Zeitungs⸗ und Druckerei⸗Unternehmen niedergelaſſen hat. Die Preſſe, die das tägliche Geſchehen widerſpiegelt und für die geiſtige Nahrung der Bürger ſorgt, unmittel⸗ bar an den Markt des Lebens gerückt— liegt darin nicht auch ein tieferer Siun? Jocco im Baſſermannhaus Beſitzer des ſchönen Hauſes am Markt waren 1834 Friedrich Baſſermann und ſeine Gemahlin Wilhelmine geb. Reinhardt. Die Frau Baſſermännin führte ein ſtrenges Haus⸗ regiment; ſie war eine Frühaufſteherin, ſah überall nach dem Rechten und duldete keinen Müßiggang. Auf dem Dach des Baſſermannhauſes hat ſich einmal Neue Mannheimer Zeitung: Festausgabe zum Einzug ins Bassermannhaus ein Vorfall abgeſpielt, der großes Gelächter erregte. Das kam ſo:. Mathn verteidigt ſich auf dem Rathausbalkon 8. April 1848 werden auf dem Marktplatze aufgeſchichtet und ver⸗ Ein Amtmann und ein Ratsherr wohnen dem traurigen Schauſpiel als Urkundsperſonen bei. Als Großherzog Leopold 1830 ſeinen Einzug in Mannheim hielt, veranſtaltete die Bürgerwehr ein ſeſtliches Biwak auf dem Marktplatz, das der Groß⸗ herzog mit ſeiner Familie beſuchte. Dem Rathaus gegenüber war das Lager der Bürgerkavallerie, auf der Neckarſeite kampierte die Artillerie, den Raum gegen die Breite Straße zu nahmen die Schützen ein und gegen G2 lagerten die Grenadiere und die Schiffer, die ſich der Bürgerwehr angeſchloſſen hat⸗ len. Pechpfannen erleuchteten den Platz, Wachtfeuer Die geſtrenge Frau Wilhelmine brachte aus Mar⸗ ſeille, wo ſie ihren erkrankten Sohn Louis Ale⸗ rander beſucht hatte, ein Aeffchen mit, Jocco ge⸗ nannt. Joecco war lange Zeit ihr Liebling, richtete aber viel Unfug an und ſpielte manchen drolligen Streich. Da war ein alter Magazinier in dem 5 Handelshauſe beſchäftigt, der trug noch eine Perücke. Eines Tages riß Joceo dem Alten die Perücke vym Kopf, flüchtete ſich damit auf das Datch, goß ein Fläſchchen Oel darüber ae, die geölte Kopfbedeckung mit der Zuhnbuürſte. Das Halloh und das Gelächter der Zuſchauer kann man ſich vorſtellen. L. G.
Beilage
140 (19.10.1929) Festausgabe zum Einzug ins Bassermannhaus - 140 Jahre Neue Mannheimer Zeitung [Beilage]
Einzelbild herunterladen
verfügbare Breiten