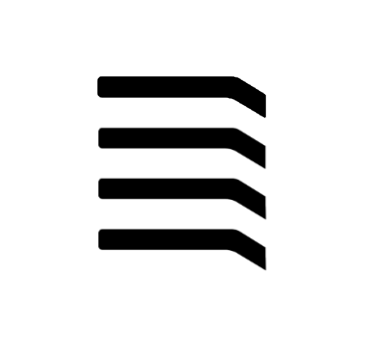e A das alte Haus gehen ſehen und wieder war es leer im zweiten Stock geworden. Die feuergefährlichen Waren, die im Hauſe lager⸗ ten, verurſachten wiederholt Brände. So brach ein großer Kellerbrand im Jahre 1880 aus. 1887 brannte das Packmagazin im Hofe nieder. Der Brand entſtand abends nach Geſchäftsſchluß. Von den Herren war niemand zu Hauſe. Da griff Frau Anna Baſſermann beherzt zu, ließ die Mägde Waſſer tragen, alarmierte die Feuerwehr und ſperrte das Hoftor vor Eindringlingen. Ehe Felix und Anna Baſſermann in den 2. Stock hinunterzogen, wurde das Haus gründlich in Stand geſetzt, Der linke Seitenbau wurde abgeriſſen, auf gle che Stockhöhe gebracht und in ihm neuzeitliche ſanitäre Anlagen und Küchenräume geſchaffen. Im Treppenhaus wurde eine Kaſſettendecke hergeſtellt, die Gänge und Vorplätze getäfelt und von dem Dekorattionsmaler Schurth aus Karlsruhe Zimmer und Treppenhaus neu ausgemalt. Die Galerien wurden von dem Glasmaler Kriebitzſch mit farbigen Fenſtern geſchmückt, deren eines auf dem Vorplatz das Familienwappen mit Anſichten von Mannheim und Worms erhielt. Ins untere Treppenhaus kamen vier von den Karlsruher Malern Romann und Kehr gemalte Anſichten der Familien⸗ häuſer von Oſtheim, Babenhauſen, Worms und Mannheim nach Weyſſers Federzeichnungen, die in der Familienchronik wiedergegeben ſind. Für das Geſchäft wurde der ganze Hof unterkellert und ein Glasdach aufgeſtellt. Im neuen Kleid prangten die alten Räume, als Felix Baſſermann mit den Sei⸗ nen im September 1892 den zweiten Stock bezog. Im Jahre 1893 kamen wieder Handwerksleute ins Haus, um die großen Flächen des oberen Tre p⸗ penhauſes mit Fresken zu ſchmücken. Die Stiftung eines Herrn von Biel gab dazu der Karls⸗ ruher Kunſtſchule einen Teil der Mittel. Felix Baſſermann ſpendete zu den Koſten von etwa 8000 ¼ die reichliche andere Hälfte. Der junge Maler Franz Hein erhielt den Auftrag. Die wohl⸗ gelungenen Bilder ſtellten dar: 1) die drei Könige, wie ſie in das Gaſthaus zu Hei⸗ delberg einziehen; 2) die goldene Hochzeit von Friedrich und Wilhel⸗ mine Baſſermann mit der Jakobsleiter; 3) Ueberfall von Felix Baſſermanns Trainkolonne 18707 4) Anſicht des Mannheimer Hafens mit Portrait von Felix, Anna, Eliſabeth und Helene Baſſer⸗ mann; 5) Chronika, Kurt und Felix Baſſermann die Ge⸗ ſchichte erzählend. Nach der Fertigſtellung der Bilder beſichtigte eine aus den Herren Claus Meier, Schönleber, Ritter, Baiſch und Krauskopf beſtehende Kommiſſion der Karlsruher Kunſtſchule die Bilder und vereinigte ſich mit dem Schöpfer der Fresken und den Haus⸗ bewohnern zu einem frohen Mahle. Die Parterre⸗ räume zur Linken waren nach Thorbeckes Auszug dem Geſchäft überlaſſen worden, das in ihnen ein Büro für die Buchhaltung einrichtete. In dem Ge⸗ ſchäft war auch Rudolf Baſſermann, der füngere Bruder von Felix, als Teilhaber tätig. Frohe Jahre haben Felix und Anna Baſſermann im zweiten Stock verlebt. Kunſt und Muſik hatten bei ihnen eine wohlgepflegte Heimſtätte. Muſikali⸗ ſche Aufführungen fanden jedes Jahr ſtatt. Die Kinder ſpielten Konzerte von Bach, Beethoven, Schumann und Mendelsſohn, begleitet von einem Dilettanten⸗Orcheſter, das der Hausherr dirigierte. Am 24. April 1898 wurde Fräulein Eliſabeth Baſſermanns Vermählung mit Fritz Seubert, dem Sohne des Majors Seubert, gefeiert und am 8. Februar 1899 traute der alte Freund der Familie, Stadtpfarrer Hitzig, die andere Tochter Helene Baſſermann mit Otto Clemm auf dem Vorplatz im dritten Stock, der wie das ganze Treppenhaus mit Blumen und Pflanzen geſchmückt war. Nun bezog Fritz Seubert mit ſeiner jungen Frau die Zimmer des dritten Stockwerkes. Ihr Stammhalter erblickte hier das Licht der Welt, wieder eine neue Generation. Als bald darauf die Beamtenlaufbahn Herrn Seubert mit ſeiner Familie nach Offenburg entführte, wurde es ſtill im oberen Stock. Es wur⸗ den Fremdenzimmer und eine Bibliothek darin eingerichtet. Nur wenige Jahre noch ſollte der lebhafte Geiſt Felix Baſſermanns in ſeinem Hauſe walten. Er, der mit ausnehmend ſtarkem Familienſinn begabt war, hing mit beſonderer Liebe an den Traditionen, die dieſe Mauern bargen. Zu früh griff des Todes Hand in ſein reiches Leben. Am 7. Mai 1902 ver⸗ ſammelten ſich im großen Saal die zahlreichen Freunde und Verwandten, die ihn zur letzten Ruhe geleiteten. Es war leer geworden in den weiten Räumen. Die Witwe Frau Anna Baſſermann wohnte mit ihren beiden Söhnen Kurt und Felix allein da⸗ rin. Noch einmal ſollten frohe Klänge durch das alt« Haus rauſchen und lachende Jugend ihren Ein⸗ zug halten. Es war, als Kurt Baſſermann ſich ſeine junge Frau Carola vom Zweig der Eiſen⸗ Baſſermanns holte.!) Wieder zogen die Jungen in den dritten Stock, der im Winter 1905/06 gründlich hergerichtet wurde. Am 22. Juli 1907 erblickte hier eine kleine Baſſermännin das Licht der Welt, die fünfte Generation, aber auch die letzte, die hier wohnen ſollte. Die Parterreräume nach dem Marktplatz waren zu wertvoll geworden, um weiterhin als Büro⸗ und Lagerräume zu dienen. Nach Zukauf des rückwärts anſchließenden Hauſes R 1, 12 wurden ſie dorthin *) Die ſog.„Eiſen⸗Baſſermannſche“ Linie ſtammt ab von dem Eiſenhändler und Landtagsabgeordneten Lu d⸗ wig Baſſermann 1781 bis 1857, deſſen Enkel Er nſt Baſſermann, der bekannte Parlamentarier und Partei⸗ führer war. veplegt. Im Herbſt 1908 wurden durch Architekt Lud⸗ wig in das Vorderhaus Läden eingebaut und die Ein⸗ fahrt, die fortan nur noch als Zugang zu den Woh⸗ nungen diente, hergerichtet. Am 1. April 1910 ſchied Kurt Baſſermann aus der Firma Baſſermann u. Co. aus, um in Freiburg bei der Süddeutſchen Diskontogeſellſchaft einzu⸗ treten. Die Firma blieb noch kurze Zeit im Hauſe R 1, 12, um dann in kleinere Geſchäftsräume einzu⸗ ziehen. Frau Anna Baſſermann blieb mit ihrem Sohne Felix allein zurück. Die Zeiten hatten ſich gewandelt. Aus der friedlichen, kleinſtädtiſchen Breiteſtraße war eine geräuſchvolle Geſchäftsſtraße geworden. Ungezählte Wagen der elektriſchen Straßenbahn rollten vom frühen Morgen bis zum ſpäten Abend vorbei. Da litt es Frau Anna Baſſer⸗ mann nicht mehr in den alten Räumen. Als letzte ſiedelte ſie 19183 mit ihrem Sohne Felix in ein Häuschen im Grünen am Luiſenpark über. Fremde Leute zogen in das Haus am Markt. Wohl blieb die Form, aber der Inhalt hatte ſich gewandelt. Das große Anweſen blieb zunächſt noch im Beſitz von Frau Anna Baſſermann und ihren Kindern, bis es im Juli 1919 an die Druckerei Dr. Haas, Mann⸗ heimer General⸗Anzeiger, G. m. b. H. verkauft wurde. * Ueber das Haus R 1, 12 iſt noch folgendes mittei⸗ lenswert: Das Haus war früher ebenſo wie das⸗ jenige R 1, 6 Eigentum des Gaſtwirtes Joh. Jak. Reinhardt. Am 20. Oktober 1835 erſteigerte Fried⸗ rich Baſſermann das Haus um 11100 Gulden, um es im Jahre 1841 ſeinem Sohne Friedrich Daniel Baſſermann als Eigentum zu übergeben. Im Jahre 1842 wurde es an Auguſt Herrſchel von Straßburg für 12000 Gulden verkauft. Im Jahre 1846 ging das Gebäude an den Weinhändler Bohrmann über, welcher es 1908 wieder der Familie Baſſermann überließ. as Marktplatz und Baſſermannhaus erlebten Von Profeſſor Dr. Friedrich Walter⸗ Mannheim Der Marktplatz iſt das Herz der Stadt. Hier drängt ſich ihr geſchichtliches Erleben zuſammen— alles, was an freudigen und traurigen Ereigniſſen auf ihre Bürger einſtürmt. In alten Städten allmählichen Wachstums grup⸗ biert ſich um ihn die früheſte Siedlung; zu ihm füh⸗ ren Re großen Schlagadern der Verkehrsſtraßen. In Mannheim hingegen war für die Anlage der künſtlichen Fürſtenſchöpfung Maßſtab und Lineal, Ueberlegung und Vermeſſung des Ingenieurs ent⸗ ſcheidend. In dem regelmäßigen, auf dem Reißbrett entworfenen Gebilde unſeres Stadtgrundriſſes wur⸗ den einige Quadrate von der Bebauung freigelaſſen und zu freien Plätzen beſtimmt, ſo auch der Markt⸗ platz. Nicht maleriſche Vielgeſtaltigkeit iſt ſein Gepräge wie in älteren Gemeinden, ſondern nüchterne Gleich⸗ mäßigkeit und ſtrenge Rechtwinkligkeit. In das durchaus ſymmetriſche Gefüge ſeiner Umbauung, wie es den Urhebern diefer barocken Stadtanlage vor⸗ ſchwebte, wurde ſchon frühzeitig Breſche gelegt. Das indiylduelle Hervorheben einzelner Gebäude ſprengte die geſchloſſene Einheitlichkeit des Platzbildes, die vielleicht nur in der Idee beſtand, auch als im 17. Jahrhundert einfache, niedere Backſteinbauten den Marktplatz umſäumten. Die Platzwände vor allem verleihen dem Platz Phyſtognomie und Eigenart. In der Geſchichte der Häuſer, die ihn umgeben, in der Wandlung ihres Aeußeren, im Wechſel ihrer Zweckbeſtimmung beruht ein weſentlicher Teil deſſen, was der Marktplatz erlebt. Erſt ſeit Beginn des 18. Jahrhunderts beſtimmt der ſympzetriſche Zwillingsbau des Rathauſes den Charakter dieſes Platzes. Vor 1622 und 1689, vor den Zerſtörungen im Dreißigjährigen und im Orleans ſchen Kriege war das Rathaus viel kleiner und einfacher. Es nahm nur die gegen die Breite Straße zu gelegene Hälfte des Baugrundſtückes ein; auf der anderen Seite entſtand in den 1680er Jahren der Neubau einer Stadtwage mit Feſtſaal, der aber ſchon nach wenigen Jahren in Aſche ſank, als die Franzoſen Mannheim niederbrannten. Im Jahre 1700 ſah der Markt die feierliche Grundſteinlegung des jetzigen Rathauſes; anſtelle der Stadtwage ent⸗ ſtand die katholiſche Pfarrkirche. Mit dem Turm in der Mitte der beiden Zwillingsflügel iſt das eigen⸗ artige Doppelkirchenmotiy der deutſch⸗reformierten und walloniſchen Kirche nachgeahmt, die auf dem Nachbarplatz R 2 errichtet war. Im Jahre 1866/67 erhielt das Rathaus den ſchon lange geplanten Er⸗ weiterungsbau gegen die Breite Straße zu. Aber nur noch knapp ein halbes Jahrhundert lenkten die Stadtväter von dort aus die Geſchicke des Gemein⸗ weſens. Mit dem Wachstum der Stadt reichten die Räume nicht mehr aus, und ſo mußte das alte Rat⸗ haus den Sitz der ſtädtiſchen Hauptverwaltung dem größeren Bruder am Paradeplatz überlaſſen. Faſt gleichaltrig mit dem Rathaus iſt das Eck⸗ hau s- 1. 1, eines der hiſtoriſch und architektoniſch bemerkenswerteſten Privatgebäude der Stadt. In keinem anderen Marktplatzbau kommt der Wechſel der Zeiten ſo ſtark zum Ausdruck wie in dieſem. Im Auftrag der in Wien zu hohem Einfluß gelangten jüdiſchen Hofbanquierfamilie Emanuel Oppenheimer, zu der auch der bekannte Jud Süß Oppenheimer ge⸗ hört, wurde dieſer ſtattliche Bau durch Johann Jakob Riſcher, Baumeiſter in kurfürſtlichen Dienſten, errichtet. Als Kurfürſt Karl Philipp nach Mann⸗ Zwei Jahre nach Karl Philipps Auszug ging das Oppenheimerſche Haus in den Beſitz des Regierungs⸗ präſidenten Grafen von Hillesheim über und führte von da ab die Bezeichnung: Gräflich Hilles⸗ heimſches Palais. Etwa ein Jahrhundert Der Marktplatz nach dem Stich von Klauber 1782 heim überſiedelte, diente ihm dieſes Haus mit den Nachbargebäuden elf Jahre lang, bis er in ſein neu⸗ erbautes Schloß überſiedeln konnte, als Notwoh⸗ nung. Der an prunktvolle Feſte gewohnte Hof Karl Philipps mußte ſich in den verhältnismäßig engen Räumen dieſer Häuſer notdürftig behelfen. ſpäter erwarb es die neugegründete Caſin o⸗Ge⸗ ſellſchaft. Damit wurde das Adelspalais ein bürgerliches Geſellſchaftshaus. Ladeneinbauten mußten es rentabel machen. Schon 1709 iſt die Einhornapotheke neben⸗ an als eins der vier vom Kurfürſten konzeſſionierten — Der Marktplatz nach dem Stich von Schnell 1840 N * Apotheken nachweisbar. Lange war ſie im Beſitz der Familie des Ratsverwandten Johann Jakob Zehner. 1721 wurde nach Liſſignolos Angabe in dem jetzt mit zur Einhornapotheke gehörigen Hauſe R 1. 2, Karl Philipps Enkelin, die Gemahlin Karl Theo⸗ dors, Eliſabeth Auguſta, geboren. Was über das Baſſermann ſche Haus, das auf mehreren vorher ſelbſtändig bebauten Grund⸗ ſtücken erſtand, zu berichten wäre, iſt an anderer Stelle erzählt. Neben der Einhorn⸗Apotheke lag in der Zeit Karl Philipps das von Haumüller ſche Haus. Die Jeſuiten hatten dort einige Jahre lang ihren Wohnſitz, bevor ſie ihr Kolleggebäude am Schloß (1731) beziehen konnten. Kurze Zeit ſah dann der Marktplatz in dieſem Hauſe Porzellanarbeiter ein⸗ und ausgehen, als Norbert Valentin Bretel darin mit kurfürſtlicher Unterſtützung den erfolglpſen Ver⸗ ſuch einer Porzellanfabrik machte, dit für das kurfürſtliche Schloß Porzellan⸗ oder richtiger Fayence⸗Prunköſen herſtellen ſollte. 1737 ging das Haus an den Wirt und Metzgermeiſter Daniel Rein⸗ hardt über. Jahrzehnte hindurch hielt manch vor⸗ nehmer Reiſewagen unter ſeinem Gaſthausſchild zum„goldenen Schaf“. Hier wohnte 1815 Feldmarſchall Fürſt von Schwarzenberg mit anderen hochgeſtellten Perſönlichkeiten. Dieſes Gaſthaus ver⸗ fiel dem Abbruch, als Friedrich Baſſermann ſein Haus erbaute. Das Eckhaus R 1. 7 war als Wirtſchaft„zur roten Roſe“ lange im Beſitz der alten Mann⸗ heimer Familie Grohe. Auch aus anderen Gaſt⸗ häuſern ſchauten in früheren Tagen Fremde auf das bunte Leben und Treiben des Platzes. So in G 2. 2, dem vielbeſuchten Gaſthaus„zu den drei Kö⸗ nigen“ des Gaſtwirts Gruber. Das 1834 an Eg⸗ linger übergegangene Haus beherbergt jetzt die Michaelis⸗Drogerie. Hier wohnte 1810 Karl Maria von Weber, und am 3. Oktober 1815 ſtiegen darin Großherzog Karl Auguſt von Sachfen⸗Weimar und ſein Miniſter Geheimrat von Goethe ab. Gegenüber im„goldenen Schaf“ wohnte Karl Auguſts Geliebte Karoline Jagemann(Frau von Heygendorf), die zu einem Gaſtſpiel in Maunheim eingetroffen war. Ein paar Häuſer weiter lag das Gaſthaus„ö u m weißen Bären“. Sein Wirt Johann Michael Berndhäuſel gab 1790 im Intelligenzblatt bekannt, daß er in ſeinem neu erkauften Gaſthauſe„Zum Bären“ auf dem Markt gute und fertige Bedienung in Eſſen, Trinken und Logieren, ſowie Stallung für 40 Pferde biete. G 2. 7 iſt das Geburtshaus des be⸗ rühmten Pfychiaters Profeſſor von Krafft⸗ Ebing(geb. 1840 in Mannheim, geſt. 1902 in Graz.) Das zweiſtöckige Haus, das mit ſeinem freund⸗ lichen Giebel von der Ecke F 2. 6 zum Baſſermann⸗ ſchen Haus herüberſchaut(jetzt Stetter), erwarb 1789, nachdem es lange im Beſitz der Ratsherrenfamilie Tremelius geweſen war, der von Neuwied nach Mannheim übergeſiedelte Handelsmann Johann Wilhelm Reinhardt. Er betrieb hier neben ſeiner Tuch⸗, Wein⸗ und Tabakhandlung ein Bankge⸗ ſchäft. Als einer der tüchtigſten und angeſehenſten Bürger von Mannheim bekleidete er 18101820 in ſchwieriger und bewegter Zeit das Amt des Ober⸗ bürgermetiſters. 5 J Das gegenüber von Reinhardt liegende Eckhaus in G 2 iſt ſchon über hundert Jahre im Beſitz der . 5*
Beilage
140 (19.10.1929) Festausgabe zum Einzug ins Bassermannhaus - 140 Jahre Neue Mannheimer Zeitung [Beilage]
Einzelbild herunterladen
verfügbare Breiten