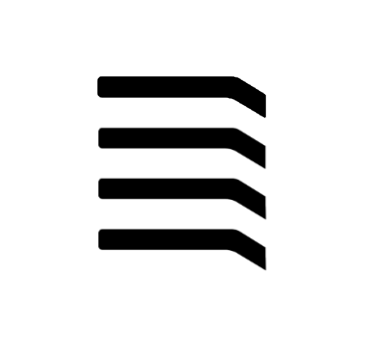Warum am 1. Januar? Betrachtung eines Astronomen Wir reißen das Deckblatt des neuen Ka- lenders ab und sehen die rote Felertagszit- ter: 1. Januar. Da taucht gleich wieder die unerbittliche Frage des Astronomeri auf- „Warum gerade der erste Januar, könnte nicht jener beliebige andre Tag Jahresan- tang sein, ist dieses Datum duych irsend- ein Naturereignis besonders ausgezeicnnet? Leider nein, der 1. Januar als Jahresbeginn ist tatsachlich eine ganz willkürliche Kin- kführung, die alLerdings schon ein ehrwür⸗ diges Ater hat. wenn wir uns unsere Monatsnamen näher ansehen, bemernen wir, dalh September, Oktober. Novemoer und De-nber so viel wie Siebehter, Ach- ter usw. heihen, obwohl sie in Wirklichkeit der neunte, zehnte usw. sind. Da stimmt schon etwas nicht. Tatsächlich haben die Römer ursprünglich das Jahr mit dem März, dem Monat ihres wichtissten Gottes, des Kriegsgottes, begonnen. Sinnvoll stand der Jahresanfang zu Beginn des pflanz- lichen Lebens im Frühlinz. Mit Jahresbe- Sinn traten aber auch die Konsuim ihr Amt an, die sich gleich zu den Leaiomen bega- ben. Als die Grenzen Roins schliebuch weit von der Hauptstadt entfernt verlielen, brauchte die Reise der Konsuln an die Kriegsschauplätze geraume Zeit., Mit Ein- tritt der besserne Jahreszeit nahmen aber die Kriegshandlungen nach der, Winterruhe Wieder ihren Fortgang, die Konsuln aber kamen zu spät. So wurde einfach der Jah- resbeginn auf den ersten Januar verlegt, Jahresbeginn und Amtsantritt der Konsuin fielen wieder zusammen urid die Konsuin kamen rechtzeitig bei Bezinn der militär' schen Operationen zu ihren Legionen. 30 wurde der Januar zum ersten und der Februar zum zweiten Monat des Jahres. Uebrigens wissen wenige die Bedeutung und den Ursprung unserer Momnatsnamen, s0 weit sie nicht die schon erwähnten Zäh- lungsbegriffe sind. Februar koinmt von Plutus Februus, vom reinigenden Pluto der Unterwelt, mit Februar sank das alte römi- sche Jahr gleich den Seelen der Verstorbe- nen ins Dunkel der Zeit und wurde einem reinigenden Prozehß unterworfen. Der Marz erinnert an den Kriegsgott Mars., der April an den Lichtgott Apollo Aperte., von ape- rire- öfknen. Der Mai sehört dem Jupi- ter Majus, dem herrlichsten Göttervater, und der Juni dessen Gemahlia Juno. Im Juli und August werden wir an die großen Römer Julius Cäsar umd Kaiser Augustus erinnert. Daß der April einmal„Nere“ und der Oktober„Domifianus“ geheißen hat, sei als Kuriosum, das nur Episode blieb, erwähnt. Das schwierigste Khalenderproblem ist die »Uebereinstimmung der Erdrotationen mit einer Umdrehung u die Sonne. Leider hat hier die Natur eine Laune geoffenbart, indem auf einen Umlauf um die Sonne keine ganze Zahl von Tagen kommt Auf ein Jahr fallen 365,2422 Tage. Um den Ka- lender, die Tageseinteilung, mit dem jan- reszeitlichen Ablauf ffür lange Zeit in Uebereinstimmung zu erhalten, sind kom- plizierte Schaltmethoden nötig. einmal muß ein Tag dazukommen, dann wieder ausge- lassen werden. Unser gegenwärtiges Schalt- system, das auf die gresorianische Kalen- derreform des italiehischen Gelehrten Luigi Lilio zurückgeht, nachdem bereits der große deutsche Astronom Regiomontanus, gest. 1476, daran gearbeitet hatte, ist von solcher Genauigkeit.“ daß ein Kalenderjahr im Durchschnitt nur 12 Sekunden länger ist als ein wirkliches Sonmeniahr und erst nach 3320 Jahren ein Tag zu viel gezählt wird. Es ist der alte Vorwitz der Menschheit: an der Schwelle des neuen Jahres möchte sie einen schmalen Blick in das Künftige tun. Wenn in der wendenden Nacht die Uhren zwölfmal schlagen, scheint die Zeit kür Sekunden ein erfaßbares, erschaubares Räderwerk, als gebe es da einen Augen- blick, in dem die Meisterin Geschichte hör- bar das Uhrwerk des neuen Jahres aufziehe, %o% doß es nur eines kühnen Blickes durch den Türspalt der Werkstatt bedürfe, um zu hen. weilche Spulen sie für den künftigen Werkgang bereitgestellt habe. Nur diesen Sinn hat es, wenn der Neurierige flüssiges Blei ins Wasser gießt, um aus Kante und Jacke des geronnenen Gebildes ein Zeichen der Zukunft abzulosen. Und nur'esem allzu wmenschlichen Wonsche gehorchen alle die Volksbrävche., die in der großen Wech- selstunde an die Tür des Geheimnisses pochen. Oh Wallenstein einst den Sterndeuter Seni befragte, um aus der Stellung der Ge- stirne kommendes Scbicksal zu erfahren, oder ob wan im Altertum das im geheim- nisvollen Urdoempf wonende Orakel Zzu er- forschen sychte: die Antwort bleh rätsel- haft wis die Sterne seihst in den Dämme— vupren des Himmels oder wies nur orabel- haft ins Ungewisse. Als Aexander der Große vor ienes kunstvoll geschlungene Gobiide geführt wurde. das in die Ge— »chichte als der„gordische Knoten“ ein— gegangen ist, raunte wan ihm zu: wer ihn nlösen wisse, werde der Herr Asiens sein. Alexander- so berichtet die ferne Kunde — rorhieb den Knoten mit seinem Schwert umnd bekennte sich damit zuv der geschicht- iehen Einsicht: nur eine Tat zeugt die Zukunft. Zukunft ist im wörtlichen Sinne das. „was zu uns kommt“. Nur das, was man energisch ruft, kommt zu uns. Auch die Zeit gehorcht dem stärksten Befehl. Für Völker, die keine Order mehr an sie haben, wächst das Zukünftige wie ein drohendes Gewicht, das sie überrollt. In gemäch-— licheren Tagen des alten Wien lebte man zukunftslos: Trink deinen Wein, Nachbar, und laß doch die Zukunft. Der Heurige ist gut, was schiert uns der Künftige, der vielleicht sauer wird.- Es war die Stimme des alten Johann Nestroy, der in seinem Bühnenstück„Die beiden Herren Söhne“ einmal in solcher Art dem Künftigen ab- winkt:„Oh. für die Zukunft gibt's schon ein Mittel. Gar nicht dran denken! Die Zukunft ist eine urdankbare Person, die grad nur die quält, die sich recht sorgsam um sie bekümmern Wenn aber die Gegenwart eine„undank- bare Person“ scheint, zieht man der Zukunft um so lieber schon freundlichere Gewänder an, woraus erhellt, daß man aus schweren Zeiten heftiger an die Türen pocht, hinter denen das Kommende rätselhaft bereitstehi. Nicht jedem ist die schlichte Philosophie jenes Steinklopfers gegeben, den Ludwig Anzengruber in seinem Bühnenwerk Die Kreu/elschreiber“ sagen läßt:„Es kann zühlt nimmer, wann's vorbei is! Ob d' ſetzt gleich sechs Schuh tief da unterm Rasen liegst, oder ob dös vor dir noch vieltausend- mal siehst- es kann dir nix'schehn! Du gehörst zu dem allm yund dös alls'hört zu dir! Es kann dir nix gschehn!“ Steinklopfer wissen eben, daß Steine ge- Erich Dolezal. Besuch Erinnerung an Norwegens berühmtEn Musiker Der Wes, der uns üsder Bergen führte, riet mit dein Namen] der Stadt zugeich.e Erimerung an Grieg wach. Die Stadt war seine nelmat und zwischen den vie-erlei Reisen durch ganz KEuropa hat es inn immer wieder Bierher zurüchgezogen. Der Sradchark entläld, sein Stand-id: 50 mag der winzige Mann durch die Gassen geschritten sein, den Schhumrbart in die Luft stechend, den Kopf mit einer Fragen- den Geoarde nach oben gewamdt. Wir la- sen den Namen Troldhaugen.( Wem fällt bei seinem Klang nicht Griegs Hochzeits- marsch ein? Wir beiden Soldatem, die der Zufall hier vorbeigeführt hat, demnen, dals es wohl der Mühe wert ist, nach diesem Ort hinauszufamen, dessen Nanne duren ein Musikstück in aller Welt berühmt ge⸗ Worden ist. So bringt uns der Zug aus Bergen, das Zu Griegs Jugendzeit nocn ein Kleines vi- scherdorf war, nach dem Vororit Hop. An dem sonnisen Sonntagnachmittzag sind wir nicht die einzigen, die die Griegsstätte auf- suchen. Norwegen ist nicht reich an großen Mannern, aber auch die wenisen nenmen im Alltag dieses Volkes nicht den Platz ein, den man vermuten sollte. Es kann hier unter Umständen schwierig sein, sich Ib- sens Werke zu verschaften. Mit“ Grieg scheint man eine Ausnahme u machen. Seine Musik ist hier populär wie keine andere. So pilgert auch jedermhnn zu dem Sommersitz, in dem er seine Reiſſę,ahre ver- bracht und die berühmtesten seimner Werke geschrieben hat. ————— Der schmale Pfad, der von Hlop nach Troldhaugen führt, windet sich j zwischen hohen Hecken und gibt dann nerwartet den Blick auf den Fjord frei. utf einem Felsen, ins Meer vorgeschoben, Isteht das graue Holzhaus mit Turm und Walkon, so recht im Geschmack von 1390. ber wel⸗ chen Ausblick eröffnet diese Fꝙlskuppel! Das graue Wasser des Fjordes, 1 dahinter weit geöflnet die Berge, schfwarzgrau, staubgrau, perlgrau, alle Abstufiüingen he- ben sich leuchtend von einandef ab. Der Ausblick atmet unerschöpfliche uhe, alle Linien dieses Bildes münden in qdie weiche, fliehende Horizontale. Ganz vorne ragen ein paar Felsbuckel aus dem Wasser, auf Inseln wachsen kleine Kiefern qind Bogen- brücken führen von einer zur arfderen. Wie japanische Tuschezeichnungen utet die- ser Back an. Das ist die Traunnlandchaft der Peer Gynt-Musik, das Sechnland der „Morgenstimmung“. Nicht bloß„Peer Gynt“ nicht oſ5 die „Hochzeit auf Troldhaugen“, auch dic mei- sten der„Lyrischen Stücke“ entstalnden hier, die„Sigurd Jorsalfar“-Musik und „Olaf Trygvason“. Freilich verbrachtte Grieg- wie alle bedeutenden Norweger es 0 hämmert werden, eh sie ins Pflaster passen dir nix'schehn! Selbst die gröſt Marter und ebene Bahn dem Kommenden geben. Wir alle haben wohl eine Rolle in der Ge⸗ schichte, aber wir möchten sie erkennen, heute und morgen. Schopeahauer hat es ein- mal zum Ausdruck gebracht, was am Men- schen auf der Schwelle zwischen Gegen⸗ wart und Zukunft wissensbegierig nagt: „Ein wichtiger Punkt der Lebensweisneit besteht in dem richtigen Verhältnis, in wel- chem wir unsere Aufmerksamkeit teils der Gegonwart, teils der Zukunft widmen, damüt nicht die eine uns die andere verderbe. Viele leben zu sehr in der Gegenwart: die Leicht- sinnigen; andere zu sehr in der Zukunft:⸗die Ansstlichen und Besorgten. Selten wird einer genau das rechte Maß halten.“ Nun gut, das also mag„Lebensweisheit“ sein, aber wir alle sind nicht weise, und manchmal rüttelt uns die Gegenwart zu sehr, um weiter zu sehen als bis zu ihren groben Pflöcken, und mitunter reißt es uns geradezu mit geschiehtlichem Drang, zu er- fahren, wo die Erfüllung all unseres Trach- tens winkt. Wir nehmen die Zukunft nicht wie ein blindwaltendes Schicksal, vor dem die Men- schen einst bebten, wenn sie im Anblick eines feurigen Fahnensterns„Not, Dürcen und Pestilen-“ erwarteten, und wir lächeln allenfalls beim Bleigießen in der Silvester- tige einmal mit dem Handgreiflichen spie- len möchte.„Zukunft sehen“ ist uns heute etwas, das aus der Tiefe des geschichtlichen und volklichen Raumes kommt und seinen Willen ins Kommende lenkt. „Ich komme, ich weiß nicht woher! Ich gehe, ich weiß nicht vrohin! Mich wundert, daß ich so fröhlich bin.“ Es ist ein uraltes Verwundern in diesem uralten Spruch: die schlichte Ahnung, daß man wohl auf dem rechten Wege ist. Diese innere„Fröhlichkeit“ diese mutvolle Stärke- wird um so lebendiger in uns wir—- ken, wenn Herkunft und Zukunft unseres Weges sich immer deutlicher abzeichnen. Sie war von einem zarten, schimmernden „Blau, das von einem Netz goldenen Geranks durchwoben wurde: altes, gutes Porzellan, durchscheinend und dünn. Vor Zeiten war es als feiertägliches Einzelstück aus den standen und stand nun auf der dazu ge- hörigen schimmernden Unertasse im Glas- auhßergewöhnliche Freude an derlei Dingen besaß und allerlei Gerätschaften sammelte, die künstlerisches Handwerk verrieten. Weil diese Tasse ihm über die Maßen ge- flel, erwählte er sie trotz ihrer Zerbrech- lichkeit zu seiner Kaffeetasse und trank daraus allmorgend'ich den heißen Trank, den ihm die junge Frau lächelnd am Früh- stückstisch darbot; ein Bild, das seine schön- heitshungrigen Augen immer wieder neu er- kreute, wenn die dünnwandige Schale, aus der feiner Dunst wölkte, in den schmalen Händen der Frau einen Augenblick ver- harrte, bevor sie mit achtsamer Gebärde auf Troldhaugen/ wo cres iebte taten- einen großen Teil seines Lebens auherhalb des Landes. Daß Bersen die regemeichste Stadt Europas ist, hatten auch wir erfahren. Der schwächlichen Gesund- heit des zarten, kleinen Mannes war sie kaum Zzuträglich. Wenn er nicht gerade in nom oder Faris lebte, Zing er den wWinter über zumindest nach Kopenhagen. Die kurzen norwegischen Sommer aber, in denen sich gleichsam alles Blühen und Rei- ken eines ganzen Jahres in wenige Wochen zusammenzieht, sahen ihn hier Aus einem kleinen, bis dahin musikalisch unm ligen Land hervorgegangen, konnte Grieg sich erst spät dieses Heim gründen. Troldhau- gen- das war für i! nicht nur die Bleibe es war der Erfolg, die Anerkennung be⸗ ruhigtes Schaflen inmitten eines Kreises von Freunden und Schülern.„In diesen Tagen,“ schrieb er 1884, als er dies Haus baute,„weiß ich wah-aftig nicht, ob ieh Musiker oder Baumeister bin Alle Ideen werden dort oben verbraucht und ungeborene Werke werden massenhaft von dem Erdboden verschluckt.“ Den persönlichen Spuren begegnen wir hier oben noch auf jedem Schritt. Die meisten älteren Bewohner des Ortes erin- nern sich noch des schmalgliedrigen klei- nen Mannes, der hier alljährlich für einige Sommerwochen eine Art Hof hjelt. Wer im geistigen Norwegen etwas zu sSagen hatte, war Gast auf Troldhaugen. Ibsen, Björnson, Svendson, sie alle kamen den umbuschten Weg heraufgefahren und waren Gäste Edvards und Frau Ninas. Das Mu-— Sikzimmer weist noch manche persönliche Erinnerung auf. Frau Nina hat ihren Gat- ten um nahezu dreißig Jahre überlebt und starb erst vor einem Jahrzehnt. Von ihr sehen wir eine moderne Photographie, die das scharfgeschnittene Gesicht einer ur- alten Frau mit ungewöhnlich klugen Augen zeigt. Daneben hängt ihr Jugendbildnis; darauf ist sie ein reizvolles junges Mäd- chen in der Art, die Renoir zu malen liebte. Demals war Nina eine Opernsängerin von groher Zukunft, und die Eltern konnten nicht verstehen, warum sie den kleinen Grieg heiratete, den Musikus,„der nichts hatte und dessen Musik niemand bören wollte“. 3 Wie reizvvoll, heute, ein halbes Jahrhun- dert nachher, die kleinen Schwächen der Griegs so liebevoll konserviert zu sehen! Das Haus enthält noch zwei Maskotten, die ihrer glückbringenden Wirkung wegen ge- hütet worden waren: diejenige Frau Ninas war ein kleines Schweinchen, Edvard aber besaß als Gücksbringer einen entzückend homischen Troll, aus rotem und schwarzem Tuch in der Art geschnitten, in der man bei uns im Derember die Krampusse machte. Da steht auch noch die Kienje, der kunstvoll aus Holz geschnitzte Krug, der zum Rundtrunk herumgereicht wurde. Und hier liegen auch noch die alten No- tenbände, Schubertlieder und Kammermu- sik, aus denen der Meister spielte, steh der Steinwegflügel, den Bergener Musik- freunde ihm zu einem Geburtstag schenk- ten. Das Klavier freilich, an dem seine Werke entstanden, war ein kleines Piano und es stand nicht hier in der Villa, sondern in der winzigen„Komponistenhütte“, einer Art Salett, die er sich unten am Fjord an- gelegt hatte. Sie enthält wenig mehr als den Schreibtisch mit dem breiten Partitur- pult und von hier kann das Auge weit hin- aus auf den silbrig schimmernden Fiord wandern. Die andere Seite der Felskuppe aber, wo das Gestein in senkrechtem Fall zum Wasser abstürzt, enthält inmitten die- ser Wand eine Steinplatte, die bloß die beiden Namen Edvard und Nina Grieg trägt. Hinter ihr ruht die Urne des einsti- gen Herren von Troldhaugen, der den Na- men des kleinen norwegischen Landsitzes berühmt gemacht hat in aller Welt. Das Meer, das immer noch in seifier Musik wei- terklingt, rollt in leisen Wellen gegen den Fels. Otto F. Baer. „Best des Jahres⸗Vergessens“ ar- Die Japaner nennen Neujahr das„Fest des Jahres-Vergessens“ oder die Jahres- abschiedsfeier, bei der es recht lustig zu- gehen muß, um auch leicht und gründ.ich die Sorgen des vergangenen Jahres ab- schütteln zu können. „Am Neujahrsmorgen, da fühlt man sich wie im goldenen Zeitalter“, singt Maritaki, ein japanischer Dichter, und um dieses Wohlgefühl ja ergieb'g zu genießen, krab- belt die Familie am Morgen frühzeitig aus den Federn, jeder„ein neuer Mensch an Körper und Geist“. Dann begibt sich der Hausvater zum „Wasserschöpfen“, einem Brauch, den wir vor allem am Osterfest kennen. Der Emer ist festlich geschmückt und bevor er in die Tiefe der Hauszisterne hinabfährt, wirff der Hausvater den Göttern des Wassers ein paar Körnchen Reis als Opfergabe zu. Deses „erste Wasser“ wird zur Bereitung des Neu- jahres-Glücks-Tees“ benutzt, zu dem man konservierte Pflaumen genießt, deren zu- sammengeschrumpfte Haut langes Leben und hohes Alter verheißt. Danach entzündet der Hausherr feierlich das Feuer für das Neujahrsessen. gedömof- ten Fisch mit bhesonders gewürztem Reis- wein. Man darf kein„altes“ Feuer aus dem vergengenen mit ins neue Jahr hinüber- nehmen. Doch bevor es zum Essen geht, ist Haus- — Blick in die Zukunſt 7 4 Betrechtung an zehresschwelle nacht, wei! unsere Phantasie um das Künf- Händen eines phantasievollen Meisters ent- schrank des Lehrers Hans Böttger, der eine * Wem einmal bewußt wird, wie aus der Mitte Europas die Kraft des„Reiches“- mochte sie gleich durch Jahrhunderte verdunkelt werden- zu einer immer stärkeren Willens- macht aufwuchs und Träger ordnender Ge- dankenwelten wurde,- ja, wem es erkennt- lich wurde, wie dieser Erdteil des Geistes von der Geschichte aufgerufen wurde gegen die Erdteile flacher und nüchterner Stoff- lichkeit, stets auf einer höheren Ebene kämpfend, die nicht mehr nur um Grenzen und Märkte focht, sondern um gerechte Da- seinsformen, der sieht in der Geschichte auch das Geschichtete und im Geschehen- den das Kommende. Warum wundern sich die amerikanischen Zeitungsmänner über den unentwegten Sie- gesglauben aus dem Munde deutscher Kriegsgefangenen? Weil sie den Gang der Geschichte abhöngig meinen von der Stück- zahl der Geschütze, während die Deutschen ihren Weg upd ihr Recht sehen. In Ueber- see wiegt man die Historie nach Tonnenge- wichten ab, in Deutschland nach der Kraft der Idee. Was einer will, das wir d! Nur wer auf- hört zu wollen, fällt unters Mühlrad der Zeit. Die großen Erfinder haben Zukunft gemacht, indem sie wußten, was sie woll- ten. Das Wie mußten sie erst ergründen in zähen und schlaflosen Nächten. Und das ist das Grohße an großen Männern, daß sie gleichsam die Ahnung des Zukünftigen mit sich tragen. Mehr als einmal in der Ge-— schichte haben sich Führernaturen damit ihre Gefolgschaft gewonnen, daß an ihrer Stirn sichtbar die Zeichen der Zukunft standen. Man kann nicht immer eindeutig sagen, woran diese geschichtliche Wixkung liegt, aber zu einem überzeugenden Teil war es jeweils der Umstand, daß das Format ihres Willens übereinstimmte mit der Wucht einer gewaltig aufdringenden Idee. Es waren solche Naturen, die wie Alexander den gordischen Knoten aller möglichen Schwierigkeiten mit der Kraft ihres Ent- schlusses zerteilten. Und derart hört man in ihren Schritten das Zukünftige schreiten. Sie sind die großen Zeichengeber der Geschichte: was sie bewegen. ist die Ge⸗— genwart, und was sie weisen. die Zukunft. Dr. O. Wessel. Die blaue Tasse/ Von Rudolf Witz any auf das schimmernde Tischtuch gesetzt Wurde. Auch die Gewöhnung des täglichen Ge⸗ brauchs vermochte die Freude an dem sel- tenen Besitz nicht zu mindern, und wenn Freunde und Besucher, die es besser wissen Wollten, zweifelnd meinten, daß dies Gefäſs eigentlich eine Teetasse wäre, dann lächelte der Lehrer Hans Böttger nur mild und über- legen. Er wußte es besser.. Die Frau verstand den Wunsch des Man- nes, auch den Alltag mit den schönen Dn- gen zu verbrämen und half ihm getreulich dahei. Dann kam der, Krieg und holte den Lehrer unter die Schdaten. Da stand die blaue Tasse, in kaltem, hochmüt'gem Glenz funkelnd, unbenützt und feiernd hinter dei geschliffenen Glasscheibe des Schrankes, und wenn die Morgensonne in ihrem goldenen Gerank Funken schlug, schaute die Frau mit weiten Augen verloren auf das seltsame Ge- fäß, bis ihr die Lider brannten. Wie sich die täglichen Dinge in Abwehr verwandeln kön- nen! Fast tat ihr der Blick auf die vertraute Tasse weh. Aber im letzten Urlaub wurde dies aut einmal anders, ganz anders. Der Mann hatte wieder allmorgendlich aus der Tasse ge- trunken, und aus der Art, wie er sie ergriff, spürte man, daß er den Besitz in'esen gedrängten Tagen noch bewußter genoß, ↄls ehedem. Da kam der letzte Morgen. Es war noch so früh am Tag, daß keine Sonnenstrahlen Funken aus dem Goldgerank schlagen konn- ten. Nur das gelbe Licht des Wandleuchters umwob den Frühstücks' isch mit einem spär- lichen Glanz. Die Frau sah, wie der Mann eine Weile verharrte, da er den letzten Schluck aus der blauen Tasse getrunken, dann setzte er die Schale mit einer behut- samen, schier zärtlichen Gebärde des Ab- schiednehmens auf das blaue Un'erteller- chen und erhob sich mit einem Ruck, wobei er tief aufatmete. 4* Die Frau ging mit ihm. Es wurde auf die- sem Wege nicht viel gesprochen. Und als die Frau in die stil! gewordene Wobnung heimhehrte, war ihr Herz schwer und voll des Abschieds, so daß sie die blaue Tasse vom Tisch räumte. weil ihr Anblick weh'!at. Nach einer Weile mußte sie indes wieder aufstehen. griff vonn neuem nach dem por- zellan und drehte es in den Händen. Und sie fünite dumpt, daß dieses Ding irgendwie andacht, bei der der Vater oder der älteste Sclan namens der Familie den„Neuen Früh- ling“ willkommen heißt. Und dann beginnt der Tag, den Essen, Trinken und Vergnügtsein erfüllen. Reis- kuchen sind die Leckerbissen und andere gute Dinge.„Ohne Neujahrsessen keine rechte. Neujahrsstimmung“, sagt Gyoji. Die Kuchen liegen appetitlich aufgemacht auf einem Holzgestell mit immergrünen Zweigen und eßbarem Seetang verziert, mit Golſfkraut, Krebsen, Apfelsinen und ande- ren Leckereien umgehen. Wer Lust hat, nimmt und ißt. So recht viel Zeit dazu ver- bleibt einem allerdings nicht, denn immer wieder treffen neue Gratulanten ein, brin- gen zierlich verpackte Geschenke, papierene „Schatzboote“ oder trockene Seechren, die man in die Länge ziehen kann wie ein Das Ewige Von Richard Gerlach In der Zeitlosigkeit ruhend, dauert das Ewige unzerstörbar und unwandelbar. EA lebt rein in der Idee, und es wäre nichts als ein allgemeiner Begriff, wenn seine Wirklichkeit nicht aus den Sternen, aus den Meeren, aus den Wolken, aus den Gebirgen und aus den Buchenkronen zu uns spräche, Unsterblichkeit ist ein Traum der Men- Schen, die nicht glauben wollen, daß ein Duft spurlos verwehen und daß ein Lä- cheln völlig verblassen kann. Die edeln Herzen pochen in der Erinnerung weiter, Aber das Ewige ist nicht von Vergänglich⸗ keit bedroht, es schweigt von fernsten Un⸗ endlichkeiten zu uns herab. Das Einzelwesen ist der Zeit unterworfen und daher sterblich. Doch die Art des Seins, die es verkörpert, vergeht nicht mit ihm. Das„Ich sterbe nicht ganz“ des Horaz gilt nicht nur für den Dichter, dessen Verses weiterklingen. Dem in Ehrfurcht Getanen kann wie den hohen Werken der Kunst die Zeit nichts rauben, solange es Menschen gibt, die imstande sind, Taten und Werke nachzudenken. Das Griechenland der An- tike versank, aber Platon und Aristoteles Aeschylos und Sophokles erheben und er-⸗ schüttern uns noch heute, und erst wenn! niemand mehr Sinn dafür hätte, was eine Wobrheit und was ein tragisches Geschick ie Lönnte man sie vergessen. Ueber dem Menschendasein leuchtet das Universum als ein großer Gedanke und 13 3333337 TL,,-. ——————— STADT MANI 9 5 15 4 wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit fort. Wir können diesen Gedanken aus dem Wunder einer Blüte enträtseln; wir können ihn aus! den Schattierungen eines Schmetterlings- flügels ablesen; wir können ihn in dem Weg fr der Lachs vom Ozean zuf seinen Laichplätzen an den Quellen der Ströme nimmt; und auch der Fink der in? seinem Neste sitzt und die zierlichen Eier“ nachzeichnen, ausbrütet, zeugt von ihm. Linnaeus schrieb, Gott anredend, auf die erste Seite seiner Systema Naturae: Quam ampla sunt Tuba Opera! Quam sapienter Ea fecisti! Quam plena est Terra possessione Tua! Wie reich sind deine Werke! Wie weise hast du sie geschaffen! Wie voll ist die Erde von dem, was Dir gehört! Das Ewige ist ein göttlicher Schöpfungs- gedanke, den wir niemals restlos fassen, sondern nur Stück für Stück erkennen und ahnungsvoll verehren können. lebendig war, wie alle Dinge lebendig und beseelt werden durch das Herz eines Men- schen, dem sie zugehören. Sie war eben wieder dabei, die Tasse wie- der im Glasschrank zu verschließen, wo sie Warten würde auf die Heimkehr des Man- nes, als ihr ein Gedanke kam, der ihr zu- nächst wie ein Frevel dünkte: Wie wäre es, wenn sie selbst nun die Schale zum täg- lichen Gebrauche nahm? Fast erschrak sie davor. Aber dann, in einem fast trotzigen Entschluß stellte sie die blaue Tasse auf das/ weiße Tischtuch, gos zum zweitenmal den schon lau gewordenen Kaffe ein und trank nun aus der Tasse des Mannes. Und da geschah etwas Seltsames in ihr: Indes sie die dünnwandige Schale zum Munde führte, daraus vordem der Mann getrunken, verlor sie jegliche Scheu vor der Tasse und ihr Anblick tat auf einmal nim- mer weh. Ein Menschenherz ist kein Mu⸗ seum gläsern eingesargter Gefühle. Die Schale wurde ihr vertraut und wenngleie der Abschied noch nicht verwunden war konnte sie auf einmal wieder lächeln. Die schlanken Hände der Frau umhüllten das blaue Porzellan. 1 Nun würde sie jeden Tag aus der kost- baren Tasse des Mannes trinken und sie 80 kür ihn lebendig halten bis zu seiner Heſm- kehr. Auch die täglichen Dinge um uns brauchen Liebe, brauchen den Atem und die menschlihe Wärme des Blutes, wenn sie ebendig bleiben sollen. Die Frau hätte nicht sagen können, wieso sie auf einmal getröstet wurde. Sie erhob sich, wusch die Schale achtsam aus und stellte sie in den Schrank. Aber gleich vornehin, wo die Dinge des täglichen Ge⸗ brauches standen und nicht unter den Prunk, der nur für die Augen bemessen war. Sie fühlte, daß sie durch dieses kleine, abseitige Erlebnis, durch diesen Entschluf ein neues und sichtbares Band zu dem fer- nen Mann geschlungen hatte, und bis er wiederkam, würde sie ihm die Tasse auf den Tisch stellen und lächelnd bekennen, daſ sie jeden Tag daraus getrunken hatte. Ihr Lächeln verweilte unsichtbar wie der Glanz der Morgensonne, denn die blaue Tasse schimmerte fröhlich hinter dem geschliffenen Glas und aus dem goldenen bendige Funken. nische Neujahrssitten nach langem Leben, und Kinder sollst du 1 haben und Kindeskinder wie der Zitronen- baum Früchte. Mann und Frau sollen in ihrer Ehe glücklich sein wie die Lappen eines Farnblattes. So geht der Tag hin- in Friedenszeiten Die Behörden halten vom 1. bis zum 3. Ja- nuar geschlossen, am 4. Januar ist in Tokio der grohe Feuerwehrjahresſag mit hals- brecherischen Leiterkunststückchen zur Be- lustigung des Volkes und ernsthaften Lösch- übungen zur Schulung der Wehr. Am 7. Tag ist der„Tag der Frühlngskräuter“, und ers am 14. Januar werden die Dekorationen aut einem großen Platz verbrannt. Aber erst der 15. Januar, der„Tag des Dreibälleschlagens“ eine Art Volksfest im Freien, beschließt die Festzeit. M. Heinzwald. Gummbband: so lange sollst du glücklich leben. Man will selbst gehen und Bekannte und Verwandte besuchen und durch die ge- schmückten Straßen laufen, wo an ien Hävsereingängen Kefernbüsche aufgestellt sind wie bei uns Maibäume; eine Kiefei soll 1000 Jahre alt werden du auch. Oder zwei lustige. grüne Bambusbäumchen flan- kieren die Haustür, durch ein Strohseil verbunden. das mit einem scharlechroten Hummer. einer bitteren Ojanee und Farn— krautwedeln behängt ist. Der Hummer ist der altè Mensch und wiederum der Wunsch Nlufnaue hat. Angſt. lch lürchte Frost in Wintertagen, weil übel · süſh mir wird im Magen. Kartoffeln bei starbem Frost zudecken, Fenster abdichten. Bei Frostgeſahr Turen und Fenster— im Raume und es hatte die gleiche Wirkung 4 Aus dem Der Führer gende Ansprac het: Deutsches V tionalsozialistin Nur der Ja heute zu Ihner nossen und V. Die Zeit hat vc dert. Die Erei, den zwölf Mon gang des 20. meine ganze A kraft der einzi, die ich seit viel salskampf meir Denn wenn a jedes Jahr unse zeit haben, da Jahr 1944 be niemals schien sein wie in der nen Jahres, al. der anderen fol Wenn es nur Schicksal wied dann fällt neb Arbeiten aller Heimat und an nen Arbeit und Anteil an diese damit nur in d- in der denkwür Aus dem Fül Der Führer genden Tagesbe macht erlassen: 0 — Die weltente EKirieges, in der deutschen Volk herziges Ringer sein, d. h. um das Ziel der u disch-internatio die Ausrottung Wenn ich im kenntnis ausspi oder andere vie gehalten. Im 1 den Jahre moc immer wieder Mache“ erschein sicht unserer G feln. Sie wird Tätigkeit unter. fentlichen Pub durch die uns lichen Staatsme wiesen durch di wohl als durch unserer Feinde jüdisch-östliche in seiner Ausrot jüdisch-westlich Falle sollen fr. Rankenwerk erglommen die Lichter wie le- macht werden, daß ganz Ostde len- also in W abgetreten werd Ostpreuhen und Pomwern und Bevölkerunsspre er der Hoffnun ihm gelingen, o krieg noch sechs sche, d. h. Fraue Sein Schüt-lin dert, daſß) We zösische Oberhol Deutschland au entspricht, aber tischen Erklärvr juden Ehrenb ankündigt, daß gen und ausgerc wieder ist das s kunftsplanung d und Juden Mor Für mich sain. Oberra-ehu seren Feinden und nur um ih hindern. h⸗ dent-che Voflk zu machen. Fs lich die RKraft ben-hbehauptung In diesem Kar stehen wir num Er wird in dor Kriegsjahr viel den, hat-=her t. überschritt Bis zum heut 0
Ausgabe
14 (30.12.1944) 334. Zweite Ausgabe
Einzelbild herunterladen
verfügbare Breiten